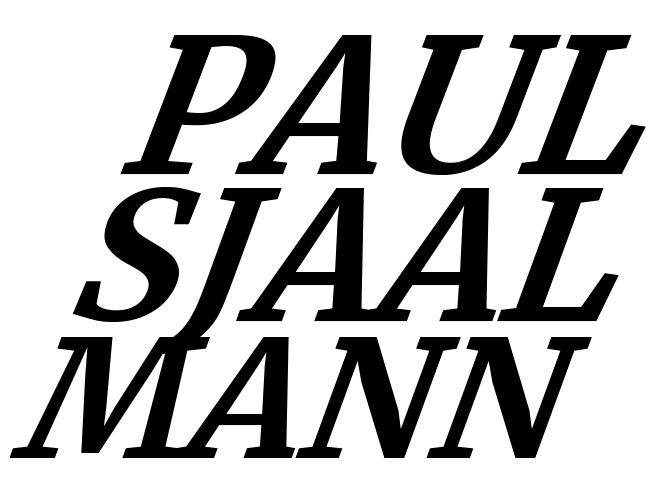Hintergrundtexte zum 'Helbig':
Von Susanne Knödel
24. September 1998 Quelle: (c) DIE ZEIT 1998
Aus der ZEIT Nr. 40/1998
Im gebirgigen Südwesten Chinas, an einer alten Handelsstraße zwischen den Provinzen Yunnan und Sichuan, leben die Mosuo. Ihre Heimat sind das fruchtbare Hochtal von Yongning und die daran angrenzenden Gebiete: ein fischreicher See, bewaldete Hänge und weiter oben im Gebirge ertragreiche Yakweiden.
Die Mosuo praktizieren eine sehr ungewöhnliche Form der sozialen Organisation: Formelle Ehen sind bei ihnen zwar bekannt, aber selten und unbeliebt; die sozial erwünschte Form der Mann-Frau-Bindung ist eine Besuchsbeziehung, die ohne Mitwirken Dritter aufgenommen und beendet wird.
Ein Mann hat auch keine finanziellen oder sozialen Verpflichtungen gegenüber den Kindern, die er gezeugt hat. Seine Fürsorge richtet sich auf die Kinder seiner Schwestern und Kusinen, mit denen er als Onkel in einem Haushalt zusammenlebt und die ihrerseits für ihn sorgen, wenn er alt geworden ist.
Zur Ehe oder zum unverheirateten Zusammenleben sind die Mosuo nur unter Druck bereit. Vor der Machtübernahme durch die Kommunistische Partei Chinas war dieser Druck demografischer Natur: Hatte eine Familie in einer Generation keine weiblichen Nachkommen, so mußte eine außenstehende Frau aufgenommen werden, um die Existenz des Haushalts fortzusetzen. Fehlten männliche Nachkommen, die körperlich schwere Arbeit verrichten konnten, nahm man den Partner einer der Frauen auf.
Nach der chinesischen Revolution reduzierten Gesundheitsprogramme Unfruchtbarkeit und Kindersterblichkeit, demografische Defizite verringerten sich. Statt dessen standen die Mosuo nun unter politischem Druck, denn die Kommunistische Partei betrachtete die Besuchsbeziehung als Relikt einer längst vergangenen Epoche, unvereinbar mit sozialistischer Moral. Von 1958 an führte sie energische Umerziehungskampagnen durch, 1975 wurden schließlich alle Erwachsenen zur Heirat mit ihren Partnern gezwungen. Ein großer Teil dieser unfreiwilligen Ehepaare ließ sich nach den ideologischen Lockerungen der Reformpolitik ab Ende der siebziger Jahre scheiden. Die eingeheirateten Partner zogen in ihre mütterlichen Haushalte zurück, die gewohnten Besuchsbeziehungen wurden wieder aufgenommen.
Die Mosuo sind davon überzeugt, daß ein Mensch am besten mit denjenigen zusammenlebt, die er von Geburt an kennt und die über untrennbare mütterliche Blutsbande mit ihm verbunden sind. Denn die Mutter ist einem Kind vom Schicksal vorherbestimmt, während der Vater als zufällig und austauschbar gesehen wird, und Partner können einander niemals so nahe stehen wie mütterliche Blutsverwandte.
Die Frauen tragen die Hauptlast der landwirtschaftlichen und häuslichen Arbeit. Sie haben aber auch einen tendenziell höheren Status als die Männer und einen leichteren Zugang zur Führungsrolle in der Familie. Männer sind zuständig für das körperlich schwere Pflügen und die Versorgung des Großviehs. Alles andere, vom Füttern der Schweine über das Jäten der Felder bis zum Kochen, ist Frauensache.
Quelle: Männer? Nur für die Nacht!
Die Zeitung untersagt das kostenlose Veröffentlichen des gesamten Interviews, C. Ryan erlaubte mir in einer Nachricht im August 2023 jedoch die Verwendung seiner zentralen Aussagen (‚Take whatever you like‘).
Wir leben in einer Zeit, in der uns die meisten Illusionen leer erscheinen: Religion, Politik, das Bankensystem – und Monogamie. Wir realisieren langsam, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Würde die Hälfte aller Flugzeuge abstürzen, würden wir sicher schauen, welche Konstruktionsfehler vorliegen. Sehr viele Ehen scheitern, trotzdem versprechen sich viele Leute ewige Treue und gehen doch fremd.
Schimpansen gelten als unsere nächsten Verwandten, werden also ständig herangezogen, wenn es darum geht, menschliches Verhalten zu erklären: Aggression, das Verhalten der Geschlechter zueinander, soziale Interaktion. Aber Bonobos sind genauso verwandt mit uns. Stellen Sie sich vor, ich hätte zwei Brüder, ein Zwillingspaar. Einer ist ein Drogenboss, der andere lebt in Indien und hilft den Bedürftigen. Aber wir sprechen nur über den Verbrecher. Schimpansen können richtig fies sein, töten Affenjunge, vergewaltigen. Sie üben Gewalt aus, um Sex zu bekommen. Bonobos hingegen benutzen Sex, um mit Stress umzugehen und Gewalt zu vermeiden. Sie schauen sich dabei sogar in die Augen, sie küssen sich, sie halten Händchen. Und Sex wird, wie Nahrung, untereinander geteilt, was für Frieden und das Wohlergehen der ganzen Gruppe sorgt.
Man kann besser verstehen, mit welchen Problemen die Leute heutzutage zu kämpfen haben. Eines davon wäre eben Treue. Und wir verstehen, warum die männlichen Geschlechtsorgane so groß sind. Bei Schimpansen, Bonobos und dem Menschen beträgt der Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen zehn bis 20 Prozent. Das lässt darauf schließen, dass es zwar einige Konkurrenz gibt, aber eher auf der Ebene der Spermien. Wer mehr Spermien hat, ist im Vorteil. Bei den Gorillas paart sich das größte und stärkste Männchen mit allen Weibchen. Diese sind in etwa halb so groß wie er. Gorillas haben winzige Penisse, ihre Hoden sind so groß wie Erdnüsse. Unsere hingegen sind im Verhältnis zu unserer Körpergröße riesig, dasselbe gilt für den Penis.
Die Pilzform hat zusammen mit dieser dem Menschen eigenen Rein-raus-Bewegung eine Saugwirkung. Die Hypothese lautet, dass diese dazu dient, Spermien eines anderen Mannes wieder aus der Frau herauszuholen. Außerdem enthält der erste Stoß an Spermien oft Chemikalien, die andere Samenzellen attackieren, der letzte enthält wiederum Chemikalien, um nachfolgende Samenzellen zu zersetzen.
bis heute gibt es bei Menschen, die noch als Jäger und Sammler zusammenleben, Regeln, wer mit wem schlafen darf und wer nicht. Und manchmal sind deren Mitglieder sogar zu Sex mit bestimmten Personen verpflichtet, Männer beispielsweise mit den Cousinen ihrer Frauen. Wer sich als Mann verweigert, gilt als geizig. Sexuelle Monogamie aber existiert bei keinem dieser Stämme.
Ihrer Vorstellung nach entsteht ein Fötus erst durch eine bestimmte Menge an Sperma. Wenn eine Frau also ein schlaues, gut aussehendes, lustiges Kind haben möchte, wird sie mit einem schlauen, mit einem gut aussehenden und mit einem lustigen Mann schlafen, um all diese Charakterzüge zu kombinieren. Wenn das Kind geboren wird, verstehen sich alle Männer als Väter und kümmern sich darum. Was dazu führt, dass es bessere Überlebenschancen besitzt als ein Kind mit nur einem Vater. Diese Stämme teilen die Verantwortung für ihre Kinder genau wie ihre Lebensmittel.
Der gängigen Auffassung nach gilt Sex als etwas Privates, das mit Scham besetzt ist. Allerdings ist es kulturübergreifend so, dass Frauen beim Orgasmus viel lauter sind als Männer. Aus Sicht unserer Vorfahren muss es dazu einen gewichtigen evolutionären Grund geben, denn es gibt Schlaueres, als einem Leoparden mitzuteilen, dass da zwei Leute gerade sehr unaufmerksam und ohne Waffen zugange sind. Es scheint, als diene dieses Verhalten dazu, andere Männer anzuziehen und so eine Spermien-Konkurrenz herzustellen.
In dem Moment, in dem der Mensch beginnt, Landwirtschaft zu betreiben. Auf einmal geht es darum, Vorräte zu horten, Privateigentum entsteht und der Wille, es an seine Kinder zu vererben. Die exklusive Vaterschaft wird wichtig und somit das Bedürfnis, weibliche Sexualität zu kontrollieren. Im Alten Testament steht: "Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weib." Wenn man weiterliest, wird die Liste fortgeführt: "Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat." Die Frau wird zum Besitz des Mannes.
Die Aussagen beziehen sich auf dieses Buch:
Christopher Ryan und Cacilda Jethá: "Sex at Dawn – How We Mate, Why We Stray, and What It Means for Modern Relationships", auf Englisch erschienen bei HarperCollins.
P.S. – Paul Sjaalmann
J.B.: Warum schreibst du? Der Helbig ist dein erstes Buch – wenngleich direkt eine Trilogie. Wie kam es dazu?
P.S.: Da tust du mir zu viel Ehre an, denn die einzelnen Teile der Trilogie gab es ja vorher schon, wenn auch eher in einer Rohfassung, was besonders für Teil III gilt. Jetzt ging es darum, alles noch einmal zu überarbeiten und aufeinander abzustimmen, damit daraus auch wirklich ein Buch wird.
Und warum ich schreibe? Aus Lust an der Kreativität und auch am Formulieren. Es ist auch ein guter Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit, die doch viel von wiederkehrender Routine geprägt ist.
J.B.: Lass uns doch mal auf diese frühe Zeit deines schriftstellerischen Schaffens blicken. Was war der Auslöser, dass du angefangen hast zu schreiben?
P.S.: Ich denke, ursprünglich ging’s mir vor allem ums Verarbeiten.
J.B.: Verarbeiten wovon?
P.S.: Vor allem von Erlebnissen auf dem elterlichen Bauernhof im Rheinland, wo ich aufgewachsen bin.
J.B.: Da denkt man doch an ländliches Idyll, das Aufwachsen mit Tieren und an eine eher glückliche Kindheit …
P.S.: Das Erstaunliche ist, dass mein Bruder diese Kindheit rückblickend tatsächlich als recht glücklich wahrnimmt. Dabei war es seine Lieblingskatze, die unser Vater vor unseren Augen erschossen hat. Und auch er musste wie ich Ferkelchen halten, die ohne Betäubung mit einer Rasierklinge kastriert wurden, wodurch man danach wegen der Schreie immer ein Fiepen in den Ohren hatte. Oder helfen, wenn abends schlafende Spatzen erschossen oder am Tag deren Nester ausgerissen wurden. Nach meiner Erfahrung wird nirgends so herzlos mit Tieren umgegangen, als ausgerechnet da, wo man am meisten von ihnen umgeben ist, auf einem Bauernhof also.
J.B.: Gibt es denn gar nichts Positives, das du aus deiner Kindheit mitnimmst?
P.S. (überlegt): Vielleicht doch. Wenn man an der Reihe war mit dem Ausmisten der Kuh- und Schweineställe, musste man da alleine durch, man stand ein bis zwei Stunden in der Scheiße und musste hart arbeiten, es half alles nichts. Oder wenn man die endlosen Reihen junger Rübenpflanzen vor sich hatte, die gehackt werden wollten, musste man einfach Reihe für Reihe hacken und weiterarbeiten. Es hat mir vielleicht geholfen, dass ich gelernt habe, gegen alle Widerstände einfach weiterzumachen: beim Wegarbeiten der Korrekturstapel, bei meinen Marathonläufen und vielleicht auch beim Verfassen des einen oder anderes Kapitels des ‚Helbig‘.
J.B.: Wie ist denn aus diesen kindlichen Erfahrungen Literatur geworden?
P.S.: Indem ich pointiert und zugespitzt habe, durchaus auch mit fiktiven Ergänzungen. So weiß ich nicht mehr, ob mein Bruder nach dem tödlichen Schuss auf seine Katze den Namen seines Lieblings wirklich so gerufen hat wie in meinem Text. Auch habe ich gemerkt, dass das Weglassen ein sehr probates Mittel ist, um die Wirkung zu steigern. Herausgekommen sind Kurzgeschichten.
J.B.: Wer waren denn die ersten Leser/innen dieser Texte?
P.S.: Das waren Mitglieder der Autorenwerkstatt als Teil der Studiobühne, der ich als Student angehörte. Da haben wir reihum eigene Texte mitgebracht und zur Diskussion gestellt. Gegen Ende des Sommersemesters haben wir dann eine Anthologie mit diesen Texten herausgegeben. Von mir waren da übrigens eher Gedichte dabei, denn ich hatte damals gewissermaßen eine lyrische Phase.
J.B.: Von denen aber keines in den ‚Helbig‘ aufgenommen wurde.
P.S. (lacht): Oh nein, mit dem Abstand von mehreren Jahrzehnten zweifle ich doch etwas an der Qualität der meisten Gedichte.
J.B.: Und bei den Kurzgeschichten ist das anders?
P.S.: Ja. Ich wollte sie in den 90ern als kleinen Band herausgeben, und der Lektor eines großen Verlags hat sie in einem Telefonat auch ausdrücklich gelobt, wegen anderer Textteile wurde mein Manuskript wie auch bei anderen Verlagen jedoch abgelehnt.
Bei ‚Tableau vivants‘, dem ersten Teil des ‚Helbig‘, bot es sich dann an, die Geschichten in Form von Kindheitsrückblenden in die Handlung zu integrieren. Bei Helbig, der da in seinem Tableau unbewegt auf dem Schulhof steht, werden Erinnerungen losgetreten, zu seinen Erlebnissen als Lehrer, aber eben auch zu seiner Kindheit.
J.B.: Die ja nicht zuletzt durchs Helbigs Eltern ausgelöst werden, die am Nachmittag kommen, nachdem Helbig schon viele Stunden in zwei Tableaus gestanden hat.
P.S.: Ja, surreal lange, niemand könnte jemals so lange stehen, das weiß man, wenn man Erfahrung im Theaterspiel hat. Aber ich fand es reizvoll, während der ganzen Handlung von Teil I Helbig als ruhenden Pol einfach nur dastehen zu lassen, während sich die Handlung um ihn herum und in seinen Gedanken bzw. Erinnerungen vollzieht.
J.B.: Dabei gibt es bei Helbig viel Frustrierendes, sodass der Lehrerberuf in keinem allzu guten Licht erscheint.
P.S.: Ja, das stimmt, obwohl ich ausgesprochen gerne Lehrer bin. Eine positivistische, harmonisch-weichgespülte Darstellungsweise ist aber nun mal nicht meine Sache. Bei einer Lesung in meinem Heimatort, einer sog. Literatursession, wurde ich mal mit den Worten angekündigt: ‚Jetzt wird’s wieder schön eklig.‘
J.B.: Wozu ja auch passt, dass du am Ende auf Helbig schießen lässt, ausgerechnet von seinem Lieblingsschüler.
P.S.: Genau. Ich denke da ein wenig wie Dürrenmatt, für den eine Handlung dann zu Ende gedacht ist, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Und ursprünglich sollte es das mit dem Schuss auch gewesen sein für Helbig. Dann aber gerieten mir diese Artikel zu einem matriarchalen Gesellschaftskonzept in die Finger, so ließ ich Helbig überleben und in Sachsen einen Neustart versuchen.
J.B.: Womit wir bei Teil II, der matriarchalen Wende wären. Für wie realistisch hältst du die gesellschaftliche Umwälzung, die sich da vollzieht?
P.S.: Es kann gut sein, dass wir in absehbarer Zukunft nichts von dem sehen, was hier beschrieben wird. Wohl am ehesten, weil es nur schwer vorstellbar ist, dass die körperliche Vaterschaft bedeutungslos wird. Trotzdem hat die Entwicklung einer gesellschaftlichen Utopie in diese Richtung voll und ganz ihre Berechtigung.
J.B.: Weil? P.S.: Weil wir die Schwächen eines Beziehungsmodells auf der Basis von festen Beziehungen und Ehen tagtäglich erleben. Die Zunahme an häuslicher Gewalt, unter der ganz besonders Frauen zu leiden haben, dominiert seit geraumer Zeit die Medien. Die Gewalt steigt das achte Jahr in Folge, und an jedem dritten Tag kommt eine Frau durch einen Partner oder Ex-Partner zu Tode. Das lässt es angebracht erscheinen, Liebe und Beziehung einmal völlig neu zu denken.
J.B.: Würdest du dich als Feminist bezeichnen?
P.S.: In gewisser Weise schon. Dabei ist mir aber wichtig, dass Männer bei einer gesellschaftlichen Verschiebung in Richtung Matriarchat nichts verlieren oder abgeben, sondern dass auch sie gewinnen. In den wenigen matriarchalen Gesellschaften, die es gibt, verteidigen die Männer diese Gesellschaftsform gegen patriarchale Einflüsse von außen. Matriarchate erleben sich selbst als Gesellschaften im Gleichgewicht.
Es gibt aus meiner Sicht tatsächlich Anzeichen dafür, dass patriarchale Einflüsse abnehmen und matriarchale zunehmen.
J.B.: Was sind solche Anzeichen?
P.S.: in erster Linie eine sinkende Tendenz, die weibliche Sexualität kontrollieren zu wollen. Ich denke, dass allgemein gilt: Je patriarchaler eine Gesellschaft organisiert ist, desto ausgeprägter ist ihr Bestreben, die weibliche Sexualität zu kontrollieren.
J.B.: In diesen Kontext stellst du in deinem Buch ja auch die Ehe, die du eher schlechtmachst. Dabei bist du selbst seit mehr als 30 Jahren mit derselben Frau verheiratet…
P.S.: Und das auch noch glücklich! Dass es wie in meinem Fall auch gut gehen kann, darf doch nicht über die Schwächen dieses Modells hinwegtäuschen, das sich tendenziell selbst überfordert. Da gibt es ein lebenslanges Glücksversprechen, das eingelöst sein will, Kinder müssen erzogen werden, häufig in der stressigen ‚Nestbauphase‘, und oft genug noch gibt’s auch noch alte Eltern zu versorgen. Und wird dann mal der Hauptverdiener arbeitslos, sind existentielle Ängste vorprogrammiert. Dass sich diese ganzen Belastungen auch in Aggression entladen, liegt auf der Hand.
Hinzu kommt ein typisch patriarchaler Blick auf die Frau.
J.B.: Das heißt was?
P.S.: Das heißt, dass Partner oder Ex-Partner für Frauen auch deshalb ziemlich gefährliche Menschen sind, weil sie die Kontrolle nicht abgeben wollen, die Kontrolle über die weibliche Sexualität. Das hat ursprünglich natürlich damit zu tun, dass ein Mann mit einer Frau nur seine eigenen Gene weitergeben und etwa Haus und Hof nicht an einen Bastard vererben will. Dass diese Kontrolle über die weibliche Sexualität der Grund für die Existenz der Ehe ist, habe ich schon Anfang der 80er Jahre in einem mediävistischen Seminar gelernt. An den Schulen weiß das heute jedoch kaum jemand, Lehrkräfte inbegriffen.
J.B.: Und bei den Mosuo aus dem Südwesten Chinas, auf die du dich in Teil II des ‚Helbig‘ beziehst, ist alles ganz anders?
P.S.: Ganz genau, wobei es diese Kultur leider nicht mehr in Reinform gibt. Sie wurde aber von Göttner-Abendroth, der Begründerin der Matriarchatsforschung, hinreichend untersucht. Und Gewalt gegen Frauen ist dieser Kultur ebenso fremd wie beispielsweise Prostitution.
J.B.: Und wie muss man sich die dazugehörige Familienstruktur konkret vorstellen?
P.S. Frauen leben in Mutterhaushalten und unterhalten Besuchsbeziehungen zu Männern, mit denen sie ansonsten keine Bindung eingehen. Deswegen trägt ein Artikel darüber auch den Titel ‚Männer?! Nur für die Nacht!‘. Die Kinder, die so gezeugt werden, wachsen im Haushalt der Clan-Mutter auf, und die Brüder der Frauen betrachten die Kinder ihrer Schwestern als ihre Kinder. Denn sie tragen ja wie sie selbst denselben Clan-Namen. Diese Männer zeugen wiederum Kinder in anderen Clan-Haushalten, mit denen sie weiter nichts zu tun haben, da sie ja einem anderen Clan angehören. Das ist ein völlig anderes Verständnis von ‚Familie‘.
Die Ehe war bei den Mosuo übrigens keineswegs verboten, aber sie war selten und unbeliebt, weil sie als die unterlegene Sozialform wahrgenommen wurde.
J.B.: Warum genau?
P.S.: Vor allem, weil man es als unverantwortlich ansah, so etwas Wichtiges wie die Aufzucht von Kindern von so etwas Fragilem wie der erotischen Anziehung zwischen Mann und Frau abhängig zu machen. Außerdem liegt es auf der Hand, dass sich oben beschriebene Belastungen wie Kindererziehung, Versorgung von alten Angehörigen und Hausbau viel leichter stemmen lassen, wenn sie sich auf mehrere Schultern verteilen. Und bei Arbeitslosigkeit können andere finanziell einspringen.
J.B.: Letzteres war ja auch bei unseren früheren Großfamilien schon so.
P.S.: Das stimmt. Und es liegt ja nur wenige Generationen zurück, dass größere Familienverbände der Normalfall waren. Bei ‚Familie‘ denkt heute jeder gleich an die eheliche Kleinfamilie, dabei ist das ursprünglich die Bezeichnung für die Menschen, die unter einem Dach leben. Und da gehörten z.B. kinderlose Onkel und Tanten auch mit dazu. Die Kleinfamilie ist ja eine vergleichsweise junge Sozialform, und es sind Zweifel darüber angebracht, ob sie sich gerade historisch bewährt.
J.B.: In Teil II deines ‚Helbig‘ gibt es ja einen deutlichen Konkurrenzkampf zwischen beiden Familienkonzepten …
P.S.: Eine solche massive gesellschaftliche Umwälzung kann selbstverständlich nicht geräuschlos vonstattengehen. Und ich fand es reizvoll, Repräsentanten beider Konzepte, die ja jeweils gute Argumente haben, aufeinander prallen zu lassen, auf der Straße, im Lehrerzimmer, in Talkshows.
J.B.: Wo Helbig da steht, scheint nicht ganz eindeutig zu sein.
P.S.: Ganz bewusst nicht. Mit Maria und Corinna unterhält er ja zwei Besuchsbeziehungen zu Clan-Müttern, selbst gehört er aber keinem Clan-Haushalt an. Nach der Scheidung hängt er immer noch seiner Ex Sabine nach, was sich auch durch den ganzen dritten Teil hinzieht. Und als er einmal eine Auseinandersetzung im Lehrerzimmer mitbekommt, steht er eher auf Seiten des Verfechters des traditionellen Familienmodells.
J.B.: Du sprichst die Auseinandersetzung zwischen der Lehrerin Silke Klar und Pastor Wiemer an. Geht es da nicht eher um Fragen des Glaubens?
P.S.: Der Streit zeigt ja gerade, wie sehr der christlich-katholische Glaube und das Patriarchat miteinander verwoben sind. Indem Silke Klar als Mosuo patriarchale Strukturen ablehnt, lehnt sie auch eine Religiosität ab, die diese Strukturen stützt und verstärkt.
J.B.: Was sie dazu bringt, ihrem Pastor-Kollegen bestimmte Sakramente vorzuschlagen…
P.S.: Mit dem matriarchalen Sakrament der ‚ersten heiligen Menstruation‘ als finale Zuspitzung, was den guten Pastor natürlich auf die Palme bringt. Aber auch der Islam als noch patriarchalere Religion bekommt ja deutlich sein Fett weg.
J.B.: …indem du aus einem vermeintlichen Artikel von Silke Klar zitierst, in dem es um einen Zusammenhang zwischen der Paradiesvorstellung im Islam und der sexuellen Frustration muslimischer Männer geht. Ist das als bloße Provokation gemeint?
P.S.: Durchaus nicht. Wenn man den Mechanismus zugrunde legt, dass Menschen sich im Paradies das herbeisehnen, was sie hier auf Erden vermissen, dann hat es doch eine gewisse Aussagekraft, wenn muslimischen Männern im Paradies 72 zum Geschlechtsverkehr bereite Jungfrauen bereitstehen.
J.B.: Und warum sollen muslimische Männer sexuell frustrierter sein als z.B. christliche Männer?
P.S.: Weil sie mit dem z.T. sehr rigiden Kleinhalten der weiblichen Persönlichkeiten durch allerlei Verhaltensvorschriften und Einschränkungen auch ein Stück weit die weibliche Libido kleinhalten. Und weil Spaß im Bett immer auch der Spaß der Gegenseite bedeutet, fällt ihnen dieses Kleinhalten wieder auf die Füße, im ‚Helbig‘ heißt es, aufs Genital.
J.B.: Denkst du, dass Frauen anders auf das Buch reagieren als Männer?
P.S.: Das kann ich schlecht sagen. Es ist sicher so, dass an Stellen, in denen es um Sexuelles geht, durchdringt, dass das Buch ein Mann geschrieben hat, und da mag für einige Frauen Störendes dabei sein. Mich beruhigt aber, dass meine Lektorin recht überzeugt ist von meinem Buch.
J.B.: Es scheint, dass du in deinem Buch ein paar allgemeine Weisheiten zum Thema Glauben und zum Zusammenleben der Geschlechter an den Mann bzw. an die Frau bringen willst. In Teil III mündet das ja in eine Vielzahl von Sachtexten, die du Helbig als seinen Nachlass verfassen lässt. Ist der ‚Helbig‘ überhaupt ein `richtiger´ Roman, wie es auf dem Cover steht?
P.S.: Es stimmt, dass es in Teil III ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den Sachtextpassagen und der Helbig-Handlung gibt. Nachdem ich von mehreren Seiten das Feedback bekam, dass einige Sachtexte mit einem gewissen Widerwillen gelesen wurden, weil man gespannt war, wie es mit Helbig weitergeht, habe ich die Gewichtung verschoben. Einige Sachtextpassagen aus früheren Versionen habe ich komplett herausgenommen, andere in die Helbig-Handlung überführt und diese dann auch noch fiktiv ausgestaltet.
J.B.: Was in dem fiktiven Schluss mündet, dass Helbig nach einem kollektiven, gleichzeitigen Orgasmus die friedlichsten Momente der Menschheitsgeschichte herbeiführen will…
P.S.: Jeder Mann kennt das Gefühl von friedvoller Mattigkeit nach einem Höhepunkt, was in dem alten Hollies-Song ‚The air that I breathe‘ besungen wird. Wie beim Stehen auf dem Hof in Teil I habe ich versucht, das so zu präsentieren, dass diese friedlichsten Momente als mögliche Wirklichkeit vorstellbar werden, das gute, alte Mimesis-Prinzip eben.
J.B.: Momente, an denen Helbig selbst nicht teilhaben kann, weil er um sein Leben ringt und letzendes stirbt…
P.S.: Immerhin geht damit ein letzter sexueller Höhepunkt einher. Und ich bleibe halt der Dürrenmatt’schen Dramaturgie von der schlimmstmöglichen Wendung treu. Und in diesem Ende laufen ja verschiedene Fäden zusammen: Helbigs schlimmster Alptraum wird gewissermaßen Wirklichkeit, und nicht nur sein ehemaliger Lieblingsschüler Malte aus Teil I, sondern auch seine Tochter Lena sind auf tragische Weise in dieses Ende verstrickt.
J.B.: Abschließend noch zu deinem Pseudonym. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
P.S.: In Teil III, wo auch Helbig dieses Pseudonym annimmt, wird ja deutlich, dass es aus dem wichtigsten Werk der niederländischen Literaturgeschichte, dem ‚Max Havelaar‘ von Multatuli, stammt. Sjaalman ist da ein geschasster Kolonialbeamter, der sich erfolglos gegen die Ausbeutung der javanischen Bevölkerung auflehnt. Der ‚Helbig‘ hat auch einen sehr deutlichen, kritischen Realitätsbezug, insbesondere durch die Thematisierung von ‚Partnerschaftsmodelle‘ und ‚Glauben‘. Da Droogstoppel im ‚Max Havelaar‘ zur Feder greift und bei mir Helbig seinen Nachlass verfasst, ist die Thematisierung des Schreibens in den Romanen eine weitere Gemeinsamkeit.
J.B.: Und warum veröffentlichst du nicht unter deinem richtigen Namen?
P.S.: Ich wollte mich wohl nicht gleich so sehr mit meinen Texten exponieren. Eine gewisse Sorge um meine persönliche Sicherheit war auch im Spiel, wenn ich da an jenen Text zur sexuellen Frustration muslimischer Männer denke.
J.B.: Warum ist es ein Problem, sich mit dem, was man verfasst hat, zu exponieren?
P.S.: Wenn ich Personen aus meinem persönlichen Umfeld meine Texte zu lesen gab, stellte ich ein z.T. erschreckendes Unvermögen fest, zwischen dem Autor und seiner Hauptfigur zu unterscheiden. Nach der Lektüre von Teil II fragte mich ein guter Bekannter mal, ob ich von meiner Frau genug hätte und mir Sex mit anderen Frauen wünsche. Mich erschreckt so etwas deshalb, weil das meine Vorstellungskraft beleidigt und weil ich diese Differenzierung von jedem Mittelstufenschüler erwarte. Grundsätzlich ist erst einmal alles Fiktion, und das gilt übrigens auch für Teil I.
So ein Pseudonym bewahrt mich vielleicht vor solchen vordergründigen Rückschlüssen, sollte mein ‚Helbig‘ wirklich einmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangen.
J.B.: Ein breites Interesse für deine Romantrilogie sei dir von Herzen gewünscht.
Zum Schluss noch etwas zu deinem kreativen Prozess. Von Simone de Beauvoir und anderen Schriftsteller*innen weiß man, dass sie mehrere Stunden täglich Schreibzeit hatten. Wie organisierst du dein Schreiben?
P.S.: Ich habe mal einen Versuch gestartet, mir pro Tag zumindest mal eine Stunde Schreibzeit zu reservieren, aber das ist kläglich gescheitert. Dabei ist es vermutlich meine Schwäche, dass ich mich zu sehr vereinnahmen lasse, besonders natürlich von schulischen Dingen. Trotzdem schießen mir zwischendurch immer mal wieder Erzählideen durch den Kopf, die ich dann auf Zettel kritzele, damit ich das später ausformulieren kann. Darauf freue ich mich dann, was vermutlich auch dabei hilft, so eine Korrektur schnell durchzuziehen. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo da mehrere Stapel gleichzeitig liegen, und dann kommt über eine längere Zeit hinweg keine einzige Zeile zu Papier.
J.B.: Wie geht es nun weiter mit deiner `Schreib-Lust´? Hast du schon Ideen für einen zweiten Roman?
P.S. Erst einmal reizt es mich, den ‚Helbig‘ als Hörbuch einzusprechen.
Dann reizt mich ein Familienroman, bei dem jedes Kapitel ganz streng der Perspektive eines Familienmitglieds zugeordnet wird. Dann soll es da einen ‚Eindringling‘ geben, z.B. einen aufgenommenen Flüchtling, der einiges auf den Kopf stellt. Der Erstling von Hugo Claus ‚De Metsiers‘ ist gerade wegen dieser Erzählweise damals ausgezeichnet worden. Auch das neuere Büchlein ‚Broer‘ von Esther Gerritsen spielt in so einem familiären Kontext.
J.B.: Wir sind gespannt! Vielen Dank für das Interview.
P.S.: Sehr gerne.
Das Interview führte Jutta Biesemann mit Paul Sjaalmann am 17. Juli 2023,
eine Woche vor dem Erscheinen von ‚Helbig auf dem Hof I – III‘.
als nicht in Goodnotes geschrieben wurde,
sondern auf Papier:
Damals gab’s Streit.
Ein Stapel leerer, unbeschriebener Blätter
liegt herum,
unnütz, wertlos, stört die Ordnung.
Weg damit
ins Altpapier,
einfach so.
Weiße Blätter,
die man beschreiben könnte,
von beiden Seiten
mit Einfällen, mit Ideen, mit kostbaren Gedanken.
Wie könnt ihr nur?!
Schnell nimmt er seiner Mutter
das Papier aus der Hand.
Nun geh schon,
nenn mich einen Geizkragen womöglich.
Dann such ich sie auf,
die geheime Schublade,
die die Bögen aufnimmt,
Bögen,
die später einmal
Schätze tragen werden,
womöglich.
Dez. 2022
Ideengebertext I zur matriarchalen Wende I
Männer? Nur für die Nacht!
Bei den Mosuo im Südwesten Chinas haben die Frauen das Sagen. Die Ehe ist verpönt, der soziale Friede großVon Susanne Knödel
24. September 1998 Quelle: (c) DIE ZEIT 1998
Aus der ZEIT Nr. 40/1998
Im gebirgigen Südwesten Chinas, an einer alten Handelsstraße zwischen den Provinzen Yunnan und Sichuan, leben die Mosuo. Ihre Heimat sind das fruchtbare Hochtal von Yongning und die daran angrenzenden Gebiete: ein fischreicher See, bewaldete Hänge und weiter oben im Gebirge ertragreiche Yakweiden.
Die Mosuo praktizieren eine sehr ungewöhnliche Form der sozialen Organisation: Formelle Ehen sind bei ihnen zwar bekannt, aber selten und unbeliebt; die sozial erwünschte Form der Mann-Frau-Bindung ist eine Besuchsbeziehung, die ohne Mitwirken Dritter aufgenommen und beendet wird.
Ein Mann hat auch keine finanziellen oder sozialen Verpflichtungen gegenüber den Kindern, die er gezeugt hat. Seine Fürsorge richtet sich auf die Kinder seiner Schwestern und Kusinen, mit denen er als Onkel in einem Haushalt zusammenlebt und die ihrerseits für ihn sorgen, wenn er alt geworden ist.
Zur Ehe oder zum unverheirateten Zusammenleben sind die Mosuo nur unter Druck bereit. Vor der Machtübernahme durch die Kommunistische Partei Chinas war dieser Druck demografischer Natur: Hatte eine Familie in einer Generation keine weiblichen Nachkommen, so mußte eine außenstehende Frau aufgenommen werden, um die Existenz des Haushalts fortzusetzen. Fehlten männliche Nachkommen, die körperlich schwere Arbeit verrichten konnten, nahm man den Partner einer der Frauen auf.
Nach der chinesischen Revolution reduzierten Gesundheitsprogramme Unfruchtbarkeit und Kindersterblichkeit, demografische Defizite verringerten sich. Statt dessen standen die Mosuo nun unter politischem Druck, denn die Kommunistische Partei betrachtete die Besuchsbeziehung als Relikt einer längst vergangenen Epoche, unvereinbar mit sozialistischer Moral. Von 1958 an führte sie energische Umerziehungskampagnen durch, 1975 wurden schließlich alle Erwachsenen zur Heirat mit ihren Partnern gezwungen. Ein großer Teil dieser unfreiwilligen Ehepaare ließ sich nach den ideologischen Lockerungen der Reformpolitik ab Ende der siebziger Jahre scheiden. Die eingeheirateten Partner zogen in ihre mütterlichen Haushalte zurück, die gewohnten Besuchsbeziehungen wurden wieder aufgenommen.
Die Mosuo sind davon überzeugt, daß ein Mensch am besten mit denjenigen zusammenlebt, die er von Geburt an kennt und die über untrennbare mütterliche Blutsbande mit ihm verbunden sind. Denn die Mutter ist einem Kind vom Schicksal vorherbestimmt, während der Vater als zufällig und austauschbar gesehen wird, und Partner können einander niemals so nahe stehen wie mütterliche Blutsverwandte.
Die Frauen tragen die Hauptlast der landwirtschaftlichen und häuslichen Arbeit. Sie haben aber auch einen tendenziell höheren Status als die Männer und einen leichteren Zugang zur Führungsrolle in der Familie. Männer sind zuständig für das körperlich schwere Pflügen und die Versorgung des Großviehs. Alles andere, vom Füttern der Schweine über das Jäten der Felder bis zum Kochen, ist Frauensache.
Quelle: Männer? Nur für die Nacht!
Ideengebertext zur matriarchalen Wende II
Ideengebertext II
war ein Zeitungsinterview mit dem amerikanischen Sexualwissenschaftler Christopher Ryan 2014:Die Zeitung untersagt das kostenlose Veröffentlichen des gesamten Interviews, C. Ryan erlaubte mir in einer Nachricht im August 2023 jedoch die Verwendung seiner zentralen Aussagen (‚Take whatever you like‘).
C. Ryan über die Zeit, in der wir leben:
Wir leben in einer Zeit, in der uns die meisten Illusionen leer erscheinen: Religion, Politik, das Bankensystem – und Monogamie. Wir realisieren langsam, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Würde die Hälfte aller Flugzeuge abstürzen, würden wir sicher schauen, welche Konstruktionsfehler vorliegen. Sehr viele Ehen scheitern, trotzdem versprechen sich viele Leute ewige Treue und gehen doch fremd.
C. Ryan über unsere nächsten Verwandten:
Schimpansen gelten als unsere nächsten Verwandten, werden also ständig herangezogen, wenn es darum geht, menschliches Verhalten zu erklären: Aggression, das Verhalten der Geschlechter zueinander, soziale Interaktion. Aber Bonobos sind genauso verwandt mit uns. Stellen Sie sich vor, ich hätte zwei Brüder, ein Zwillingspaar. Einer ist ein Drogenboss, der andere lebt in Indien und hilft den Bedürftigen. Aber wir sprechen nur über den Verbrecher. Schimpansen können richtig fies sein, töten Affenjunge, vergewaltigen. Sie üben Gewalt aus, um Sex zu bekommen. Bonobos hingegen benutzen Sex, um mit Stress umzugehen und Gewalt zu vermeiden. Sie schauen sich dabei sogar in die Augen, sie küssen sich, sie halten Händchen. Und Sex wird, wie Nahrung, untereinander geteilt, was für Frieden und das Wohlergehen der ganzen Gruppe sorgt.
C. Ryan über die Beschaffenheit der menschlichen Geschlechtsorgane:
Man kann besser verstehen, mit welchen Problemen die Leute heutzutage zu kämpfen haben. Eines davon wäre eben Treue. Und wir verstehen, warum die männlichen Geschlechtsorgane so groß sind. Bei Schimpansen, Bonobos und dem Menschen beträgt der Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen zehn bis 20 Prozent. Das lässt darauf schließen, dass es zwar einige Konkurrenz gibt, aber eher auf der Ebene der Spermien. Wer mehr Spermien hat, ist im Vorteil. Bei den Gorillas paart sich das größte und stärkste Männchen mit allen Weibchen. Diese sind in etwa halb so groß wie er. Gorillas haben winzige Penisse, ihre Hoden sind so groß wie Erdnüsse. Unsere hingegen sind im Verhältnis zu unserer Körpergröße riesig, dasselbe gilt für den Penis.
Die Pilzform hat zusammen mit dieser dem Menschen eigenen Rein-raus-Bewegung eine Saugwirkung. Die Hypothese lautet, dass diese dazu dient, Spermien eines anderen Mannes wieder aus der Frau herauszuholen. Außerdem enthält der erste Stoß an Spermien oft Chemikalien, die andere Samenzellen attackieren, der letzte enthält wiederum Chemikalien, um nachfolgende Samenzellen zu zersetzen.
C. Ryan über das geschlechtliche Zusammenleben bei Naturvölkern:
bis heute gibt es bei Menschen, die noch als Jäger und Sammler zusammenleben, Regeln, wer mit wem schlafen darf und wer nicht. Und manchmal sind deren Mitglieder sogar zu Sex mit bestimmten Personen verpflichtet, Männer beispielsweise mit den Cousinen ihrer Frauen. Wer sich als Mann verweigert, gilt als geizig. Sexuelle Monogamie aber existiert bei keinem dieser Stämme.
Ihrer Vorstellung nach entsteht ein Fötus erst durch eine bestimmte Menge an Sperma. Wenn eine Frau also ein schlaues, gut aussehendes, lustiges Kind haben möchte, wird sie mit einem schlauen, mit einem gut aussehenden und mit einem lustigen Mann schlafen, um all diese Charakterzüge zu kombinieren. Wenn das Kind geboren wird, verstehen sich alle Männer als Väter und kümmern sich darum. Was dazu führt, dass es bessere Überlebenschancen besitzt als ein Kind mit nur einem Vater. Diese Stämme teilen die Verantwortung für ihre Kinder genau wie ihre Lebensmittel.
C. Ryan über das Stöhnen der Frauen beim Sex:
Der gängigen Auffassung nach gilt Sex als etwas Privates, das mit Scham besetzt ist. Allerdings ist es kulturübergreifend so, dass Frauen beim Orgasmus viel lauter sind als Männer. Aus Sicht unserer Vorfahren muss es dazu einen gewichtigen evolutionären Grund geben, denn es gibt Schlaueres, als einem Leoparden mitzuteilen, dass da zwei Leute gerade sehr unaufmerksam und ohne Waffen zugange sind. Es scheint, als diene dieses Verhalten dazu, andere Männer anzuziehen und so eine Spermien-Konkurrenz herzustellen.
C. Ryan über den Zeitpunkt, ab wann die weibliche Sexualität kontrolliert werden musste:
In dem Moment, in dem der Mensch beginnt, Landwirtschaft zu betreiben. Auf einmal geht es darum, Vorräte zu horten, Privateigentum entsteht und der Wille, es an seine Kinder zu vererben. Die exklusive Vaterschaft wird wichtig und somit das Bedürfnis, weibliche Sexualität zu kontrollieren. Im Alten Testament steht: "Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weib." Wenn man weiterliest, wird die Liste fortgeführt: "Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat." Die Frau wird zum Besitz des Mannes.
Die Aussagen beziehen sich auf dieses Buch:
Christopher Ryan und Cacilda Jethá: "Sex at Dawn – How We Mate, Why We Stray, and What It Means for Modern Relationships", auf Englisch erschienen bei HarperCollins.
Wie lebt es sich im Matriarchat?
Wie lebt es sich im Matriarchat?"
n-tv.de: Frau Göttner-Abendroth, die Matriarchatsforschung geht davon aus, dass das Matriarchat in der menschlichen Frühzeit allgemein verbreitet war. Wie ist die Situation heutzutage? Wie viele Matriarchate gibt es noch?
Heide Göttner-Abendroth: Von den Gesellschaften, die ich als voll matriarchal bezeichnen würde, gibt es heute höchstens noch 20. Mit ausgeprägt matriarchalen Spuren und Mustern gibt es sehr viel mehr.
Wie gelingt es diesen Kulturen, mit matriarchalen Mustern weiter zu existieren, wenn die Welt drum herum so anders tickt?
Die heute noch lebenden matriarchalen Gesellschaften in Asien, Amerika und Afrika haben eine jahrhundertelange Geschichte des Widerstands hinter sich. Viele leben in Rückzugsgebieten wie Gebirgen oder Wüsten, die bis vor Kurzem einfach nicht gut erreichbar waren. Heute sind sie viel mehr von Straßen- und Industriebau betroffen, aber der Widerstand hält an. Viele von diesen Völkern haben sich in Aufständen gegen die fremden Kulturen aufgelehnt.
Sind die klassischen Matriarchate wirklich – so wie wir gern glauben wollen – das Paradies für Frauen?
Wissen Sie, ich rede nie von Paradies. Die Muster sind einfach anders. Matriarchate stärken die Stellung der Frau. Wenn die stark ist, heißt das aber nicht, dass die Stellung des Mannes schwach sein muss. Ich bezeichne Matriarchate als Gesellschaften in Balance. Ihre Muster zeigen deutlich, dass sie von einer Egalität der Geschlechter ausgehen, dass also beide Geschlechter gleichwertig sind. Jedes Geschlecht hat seine eigene Aktionssphäre und seinen eigenen ökonomischen, rituellen und sozialen Bereich. Das übertreten sie auch nicht, weil sie der Auffassung sind, dass sich die Geschlechter gegenseitig respektieren müssen, und der gleiche Respekt gebührt ihren jeweiligen Handlungssphären.
Wie sieht denn die Aufgabenverteilung aus? Was ist Frauensache und was sind rein männliche Angelegenheiten?
Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft anders. Bei den Mosuo in Südwestchina zum Beispiel, wo ich geforscht habe, sind die Männer für Fischerei und Handel zuständig. Die Frauen machen dort den Garten und Ackerbau. Das wird auch nicht vermischt. In Juchitán, das ist eine matriarchale Stadt in Mexiko, ist es genau umgekehrt
Die Männer können damit gut leben? Da gibt es keine Machtkämpfe?
Die brauchen keine Machtkämpfe, eben weil matriarchale Gesellschaften genau auf die Balance und die Egalität der Geschlechter achten. Matriarchate werden ja meist mit Frauenherrschaft verwechselt. Das ist aber völliger Unfug. Diese Stereotype "Dann geht es den Männern schlecht", "Dann müssen die revoltieren" und ähnliches Zeug, sind nichts als Vorurteile aus unseren westlichen Köpfen. Die Männer dort müssen nicht in die Frauensphäre eindringen und die Frauen nicht in die Männersphäre. Das würde man als nicht in Ordnung betrachten, weil jedes Geschlecht seinen eigenen Machtbereich hat. Matriarchale Männer – das ist sehr interessant – verteidigen ihre Kulturen intensiv gegenüber patriarchalen Übergriffen von außen. Sie leben gern in ihrer Gesellschaft.
Ist die Gleichrangigkeit beider Geschlechter das, was das Leben im Matriarchat besonders prägt?
Das prägende Merkmal ist die Ausgewogenheit in allem: bei Männern und Frauen, zwischen Jüngeren und Älteren, und vor allem auch, was ganz wichtig ist, zwischen Mensch und Natur.
Inwiefern spielt die Frau im Matriarchat dennoch die zentrale Rolle?
Matriarchale Gesellschaften sind in der Mutterlinie organisiert. Die Menschen leben in großen Clans zusammen, meist in einem Clan-Haus, und die Clans bestehen aus den Verwandten in der Mutterlinie. Deswegen sind die Mütter zentral. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dort herrschen. Sie haben einfach die größte Achtung, weil alle, die in dem Clan-Haus wohnen, ihre Töchter und Söhne und Enkelinnen und Enkel sind. Auch ökonomisch gibt es da einen interessanten Aspekt: Beide Geschlechter tragen zur Ökonomie bei. Aber die Güter werden in die Hände der Clan-Mütter gegeben, und die haben nicht das Recht, sie zu besitzen, sondern sie haben das Verteilungsrecht. Die Clan-Mütter sind dafür verantwortlich, dass die Güter gleichmäßig verteilt werden, und das bedeutet, dass alle Clan-Mitglieder gleich viel erhalten.
Kommt es trotzdem auch mal zu Konflikten? Wie werden die gelöst? Läuft das anders als bei uns?
Klar, die im Matriarchat lebenden Menschen sind ja keine Engel. Die streiten sich natürlich auch, haben mal Probleme miteinander, oder es vertragen sich zwei Clans im Dorf nicht. Aber die Lösungen für solche Konflikte sind anders als bei uns. Wenn bei uns zwei Menschen in Streit geraten, kommt es zu seelischen Verletzungen, und die beiden Menschen sind meist allein, es hilft ihnen niemand. In matriarchalen Gesellschaften ist bei einem individuellen Streit der ganze Clan da. Und wenn Clans in Schwierigkeiten geraten, dann hilft das gesamte Dorf, die Streitigkeit zu lösen. Das bedeutet: Es ist niemand im Streit allein. Es ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe, Konflikte zu lösen. Und es geschieht stets durch Verhandlungen und Gespräche. Denn so funktioniert auch die ganze politische Entscheidungsfindung. Matriarchale Gesellschaften regieren sich selbst stets durch Verhandlungen mit dem Ziel der Konsensfindung.
Das heißt, sie leben in einer Art Konsensdemokratie?
Das ist äußerst interessant: All ihre politischen Entscheidungen fallen tatsächlich in Einstimmigkeit. Und das nicht nur im Clan, sondern im ganzen Dorf und in der Region. Das geschieht über ein sehr ausgeklügeltes System von verschiedenen Räten. Der Clan-Rat kommt zusammen, dann der Dorf-Rat und dann der Regional-Rat. Die Beratungen zeugen davon, dass die Menschen eine enorm hohe kommunikative Kompetenz haben. Sie beraten so lange, bis sich über ein Problem, das die Region betrifft, alle Menschen dieser Region einig sind. Ich habe das selbst in China miterlebt. Das funktioniert. Es ist ein politisches Muster, das von vornherein Hierarchie, Klassen, Abwertung und Mundtotmachen von anderen unterbindet. Da sind alle - auch die Minderheiten - integriert, und alle haben was zu sagen. Ich muss natürlich hinzufügen: Es sind keine Riesen-Gesellschaften wie unsere, sondern kleinere.
Welche Rolle spielt die Familie und insbesondere die Vaterschaft im matriarchalen Alltag?
Die Kleinfamilie aus Vater, Mutter, Kind, wie wir sie kennen, gibt es nicht. Die Kinder gehören grundsätzlich zur Mutter und bleiben in deren Clan. Die Mütter - das ist dann eine Gruppe von Schwestern - erziehen die Kinder gemeinsam. Großmütter, Großtanten und Brüder sind auch da. Das Interessante ist: Die Brüder betrachten die Kinder der Schwester als ihre Kinder, während die in unseren Augen biologischen Väter die Kinder nicht als ihre Kinder ansehen. Das liegt an der Mutterlinie. Der Bruder der jungen Mutter trägt denselben Clan-Namen wie sie selbst und damit auch denselben wie ihre Kinder. Daher betrachten sie sich als verwandt. Der biologische Vater aber hat einen anderen Clan-Namen, nämlich den seiner Mutter. Die Nachkommen, die er mitbetreut und für die er mitsorgt, das sind die Kinder seiner Schwestern. Das ist eine ganz andere Verwandtschaftsordnung, als wir sie haben. Die biologische Vaterschaft, wie wir sie verstehen, hat für sie keine Bedeutung. Manchmal wissen sie gar nicht, wer der biologische Vater des Kindes ist, weil es sie nicht interessiert. Falls sie es aber wissen, respektieren sie das natürlich. Denn der Mann ist ja der Geliebte der Frau. Der wird gern gesehen und bekommt Geschenke. Aber er ist nicht im Clan der Frau zu Haus.
Es gibt also keine Eheschließungen?
Nein, nicht in unserem Sinne. Es sind freie Beziehungen. Die Frauen wählen sich ihre Liebsten wie sie wollen. Da gibt es dann zum Teil kurze Beziehungen, zum Teil lange, je nachdem, wie die Liebe eben aussieht. Auch die Männer sind in ihren Liebesbeziehungen frei. Das Interessante ist, dass daraus keine sozialen Probleme für die Kinder entstehen, denn die sind ja immer im ganzen Clan zu Haus und können sich ihre Bezugspersonen aussuchen, wie sie wollen. Sie sind bestens aufgehoben.
Wie lernen die Kinder? Ist das "Learning by Doing", ein Leben lang?
Ja, genau. Die Tätigkeiten von Frauen und Männern lernen die Kinder natürlich von den Erwachsenen, und die kulturellen Angelegenheiten lernen sie durch die großen Feste. Diese Gesellschaften feiern ja sehr viele Feste. Die ganzen agrarischen Feste im Jahreskreis und ihre Lebensstadien-Feste, Ahnenfeste, das wird alles mit sehr viel künstlerischem und spirituellen Aufwand gefeiert. Die Kinder lernen die Kultur, indem sie von Anfang an teilnehmen. Das ist keine Kultur wie wir sie haben, die aus Buch, Theater etc. besteht. Wir haben eine sehr abgespaltene Kultur, die oft am Leben vorbei geht. Den matriarchalen Gesellschaften dagegen ist die Erde heilig, und damit werden die Kinder groß. Es ist eine Kultur, die ständig im Lebenszusammenhang stattfindet. Ununterbrochen.
Haben wir eine Chance, matriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft zu etablieren? Sie zeigen ja eindrücklich, dass eine Gesellschaft in Balance mit ökonomischer Gleichverteilung und politischem Konsens kein idealisierter Hokuspokus ist, sondern gelebt werden kann.
Ja, es ist lebbar. Und die Frage, was wir von diesem Wissen und diesen sehr menschenfreundlichen Mustern in unsere Gegenwart übernehmen können, wird tatsächlich immer lauter, weil mittlerweile viele Frauen und auch Männer von dieser Forschung wissen. Da muss man nicht warten, bis einzelne Staaten eine Veränderung in Gang bringen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo Menschen anfangen, in ihrem Zusammenhang matriarchal zu leben. In alternativen Bewegungen werden matriarchale Clans gegründet. In der Öko-Bewegung gibt es Menschen, die ihren anderen Umgang mit der Erde als matriarchalen Wert betrachten. In manchen Gemeinschaften probieren sie auch die Konsensfindung. Die Menschen beginnen damit von unten.
Mit Heide Göttner-Abendroth sprach Andrea Schorsch
Quelle: Wie lebt es sich im Matriarchat?
Das Matriarchat ist nach ursprünglicher Definition ist eine gynozentrische Gesellschaftsstruktur, in der entweder Frauen die Macht innehaben oder die frauenzentriert ist, die Gesellschaftsordnung also um die Frauen herum organisiert ist. Ähnlich wie beim Patriarchat, bei dem es ebenso ursprünglich darum ging, dass Männer die Macht haben, ist diese Definition aber politisch umgedeutet worden, so dass ein Matriarchat nunmehr keine Machtfrage ist, sondern für davon unabhängige Strukturen steht.
Nach Heide Göttner-Abendroth gelten gegenwärtig die folgenden Kriterien für Matriarchate:
Soziale Merkmale: Die Sippen sind matrilinear strukturiert (Abstammung von der Mutterlinie) und werden durch Matrilokalität und Uxorilokalität zusammengehalten (Wohnsitz bei der Mutterlinie). Ein Matri-Clan lebt im großen Clanhaus zusammen. Biologische Vaterschaft ist neben der sozialen Vaterschaft zweitrangig. Das die Abstammung von der Mutterlinie genau so unmodern und nicht besser ist als eine Abstammung von der Vaterlinie geht dabei gerne unter. Eine moderne Gesellschaft sollte wohl einfach beide Abstammungen, die von der Mutter und dem Vater berücksichtigen. Und das solche Gesellschaften relativ starre Regeln haben, bei denen man eben in einem Clanhaus zusammenleben muss, was ich zB nicht wollte, erscheint mir auch nicht häufig thematisiert zu werden.
Politische Merkmale: Das politische System basiert auf Konsensdemokratie auf verschiedenen Ebenen (Sippenhaus, Dorf, Regional). Delegierte agieren als Kommunikationsträger zwischen den verschiedenen Ebenen. Es handelt sich um so genannte segmentäre Gesellschaften, die sich durch das Fehlen einer Zentralinstanz auszeichnen (regulierte Anarchie). Das erklärt immerhin, warum Matriarchate nicht groß werden können. Ihnen fehlt eine größere planende Instanz, die man für eine Infrastruktur und ähnliche Errungenschaften der modernen Welt braucht. Eine Autobahn zu planen ohne eine Zentralinstanz wird beispielsweise kaum möglich sein. Was das ganze allerdings mit einem Matriarchat zu tun hat erschließt sich mir nicht. Ich denke es gibt genug Frauen, die gerne mit einer zentralen Verwaltung leben und ein Repräsentationsprinzip für gut befinden. Die Behauptung, dass Anarchie gerade sehr weiblich ist, setzt eigentlich fast zwangsläufig einen Differenzfeminismus voraus und würde sicherlich in gleichheitsfeministischen theoretischen Abhandlungen abgelehnt werden müssen. Schließlich kommt es in der konstruierten Gesellschaft nur auf die Erziehung an, so dass die Vorstellung, dass Frauenstaaten anders organisiert sein müssen als Männerstaaten eigentlich inkonsequent wäre.
Ökonomische Merkmale: Es handelt sich meistens um Garten- oder Ackerbaugesellschaften. Es wird Subsistenzwirtschaft betrieben. Land und Haus sind im Besitz der Sippe und kein Privateigentum. Die Frauen haben die Kontrolle über die wesentlichen Lebensgüter. Das Ideal ist Verteilung und Ausgleich und nicht Akkumulation. Dieser Ausgleich wird durch gemeinschaftliche Feste erreicht. Es handelt sich um so genannte Ausgleichsgesellschaften. Eine Gesellschaft, die über eine Garten- und Ackerbaugesellschaft hinauskommt, bekommt damit schon einmal einen Abzugspunkt auf der Matriarchatsskala. Vielleicht ein Grund, warum „Patriarchate“ so beliebt auf der Welt sind, auch wenn Frauen mehr als die Hälfte der Wähler in freien, unabhängigen und geheimen Wahlen stellen. Denn welche Frau würde schon gerne ihre Konsumgesellschaft für eine Garten- und Ackerbaugesellschaft aufgeben? Immerhin hätte man da auch den Beleg, dass Matriarchate sexistisch sind, denn Frauen die Kontrolle über die wesentlichen Lebengüter zu geben ist zunächst einmal genau das: Sexismus. Und umgekehrt einer der beliebtesten Vorwürfe des Feminismus gegenüber dem Patriarchat. Das es dann gerecht sein soll, wenn es umgekehrt ist, dass lässt sich wohl eben auch nur mit einem Differenzfeminismus erklären, indem die Frauen besser sind als die Männer. Auch hier sollte eine Gleichheitsfeministin angewidert den Kopf schütteln, wenn sie ihre Theorie ernst nimmt und für eine Gleichberechtigung eintritt.
Weltanschauliche Merkmale: : Der Glaube, in der eigenen Sippe wiedergeboren zu werden, und der Ahnenkult bilden die Grundlage der religiösen Vorstellungen. Die Welt gilt als heilig. Die Erde als die Große Mutter garantiert die Wiedergeburt und Ernährung allen Lebens. Sie ist die eine Urgöttin, die andere Urgöttin ist die kosmische Göttin als Schöpferin des Universums. Es handelt sich um sakrale Gesellschaften. Widerliche Mutterverklärung. Das eine atheistische Gesellschaft anscheinend kein Matriarchat sein kann ist insoweit auch interessant. Auch hier scheint mir die Sichtweise nur bei einem Differenzfeminismus aufrecht zu halten zu sein. Denn ansonsten macht der hier vertreten Mutter Mythos schlicht keinen Sinn. Die Matriarchatsforschung legt damit mit ihren Kriterien einen Unterschied zwischen Mann und Frau zugrunde. Das Antje Schrupp sich damit anfreunden kann, verwundert im Prinzip nicht. Oder er ordnet positive Kriterien ohne weitere Begründung Männern und Frauen zu, was aber den Begriff Matriarchat beliebig macht. Interessant finde ich auch, dass auf den größeren feministischen Blogs, die ja allesamt keinen Differenzfeminismus vertreten, keine Kritik hierzu kommt. Interne Kritik im Feminismus ist eben unerwünscht.
Quelle: Wie lebt es sich im Matriarchat?
"Frauenherrschaft? Das ist Unfug!"
Sind Matriarchate tatsächlich das Paradies für Frauen? Wie ergeht es den Männern dort? n-tv.de spricht mit Dr. Heide Göttner-Abendroth, der Begründerin der modernen Matriarchatsforschung. Seit mehr als 30 Jahren ist sie auf diesem Gebiet aktiv. Sie kennt zahlreiche Menschen aus matriarchalen Gesellschaften und hat selbst bei den Mosuo in Südwestchina geforscht, die inmitten des chinesischen Staatsgebildes auch heute noch nach klassischen matriarchalen Mustern leben. Im Gespräch zeigt sich: Klischee und Wirklichkeit haben wenig miteinander zu tun. Und wir können viel aus dem matriarchalen Leben lernen.n-tv.de: Frau Göttner-Abendroth, die Matriarchatsforschung geht davon aus, dass das Matriarchat in der menschlichen Frühzeit allgemein verbreitet war. Wie ist die Situation heutzutage? Wie viele Matriarchate gibt es noch?
Heide Göttner-Abendroth: Von den Gesellschaften, die ich als voll matriarchal bezeichnen würde, gibt es heute höchstens noch 20. Mit ausgeprägt matriarchalen Spuren und Mustern gibt es sehr viel mehr.
Wie gelingt es diesen Kulturen, mit matriarchalen Mustern weiter zu existieren, wenn die Welt drum herum so anders tickt?
Die heute noch lebenden matriarchalen Gesellschaften in Asien, Amerika und Afrika haben eine jahrhundertelange Geschichte des Widerstands hinter sich. Viele leben in Rückzugsgebieten wie Gebirgen oder Wüsten, die bis vor Kurzem einfach nicht gut erreichbar waren. Heute sind sie viel mehr von Straßen- und Industriebau betroffen, aber der Widerstand hält an. Viele von diesen Völkern haben sich in Aufständen gegen die fremden Kulturen aufgelehnt.
Sind die klassischen Matriarchate wirklich – so wie wir gern glauben wollen – das Paradies für Frauen?
Wissen Sie, ich rede nie von Paradies. Die Muster sind einfach anders. Matriarchate stärken die Stellung der Frau. Wenn die stark ist, heißt das aber nicht, dass die Stellung des Mannes schwach sein muss. Ich bezeichne Matriarchate als Gesellschaften in Balance. Ihre Muster zeigen deutlich, dass sie von einer Egalität der Geschlechter ausgehen, dass also beide Geschlechter gleichwertig sind. Jedes Geschlecht hat seine eigene Aktionssphäre und seinen eigenen ökonomischen, rituellen und sozialen Bereich. Das übertreten sie auch nicht, weil sie der Auffassung sind, dass sich die Geschlechter gegenseitig respektieren müssen, und der gleiche Respekt gebührt ihren jeweiligen Handlungssphären.
Wie sieht denn die Aufgabenverteilung aus? Was ist Frauensache und was sind rein männliche Angelegenheiten?
Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft anders. Bei den Mosuo in Südwestchina zum Beispiel, wo ich geforscht habe, sind die Männer für Fischerei und Handel zuständig. Die Frauen machen dort den Garten und Ackerbau. Das wird auch nicht vermischt. In Juchitán, das ist eine matriarchale Stadt in Mexiko, ist es genau umgekehrt
Die Männer können damit gut leben? Da gibt es keine Machtkämpfe?
Die brauchen keine Machtkämpfe, eben weil matriarchale Gesellschaften genau auf die Balance und die Egalität der Geschlechter achten. Matriarchate werden ja meist mit Frauenherrschaft verwechselt. Das ist aber völliger Unfug. Diese Stereotype "Dann geht es den Männern schlecht", "Dann müssen die revoltieren" und ähnliches Zeug, sind nichts als Vorurteile aus unseren westlichen Köpfen. Die Männer dort müssen nicht in die Frauensphäre eindringen und die Frauen nicht in die Männersphäre. Das würde man als nicht in Ordnung betrachten, weil jedes Geschlecht seinen eigenen Machtbereich hat. Matriarchale Männer – das ist sehr interessant – verteidigen ihre Kulturen intensiv gegenüber patriarchalen Übergriffen von außen. Sie leben gern in ihrer Gesellschaft.
Ist die Gleichrangigkeit beider Geschlechter das, was das Leben im Matriarchat besonders prägt?
Das prägende Merkmal ist die Ausgewogenheit in allem: bei Männern und Frauen, zwischen Jüngeren und Älteren, und vor allem auch, was ganz wichtig ist, zwischen Mensch und Natur.
Inwiefern spielt die Frau im Matriarchat dennoch die zentrale Rolle?
Matriarchale Gesellschaften sind in der Mutterlinie organisiert. Die Menschen leben in großen Clans zusammen, meist in einem Clan-Haus, und die Clans bestehen aus den Verwandten in der Mutterlinie. Deswegen sind die Mütter zentral. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dort herrschen. Sie haben einfach die größte Achtung, weil alle, die in dem Clan-Haus wohnen, ihre Töchter und Söhne und Enkelinnen und Enkel sind. Auch ökonomisch gibt es da einen interessanten Aspekt: Beide Geschlechter tragen zur Ökonomie bei. Aber die Güter werden in die Hände der Clan-Mütter gegeben, und die haben nicht das Recht, sie zu besitzen, sondern sie haben das Verteilungsrecht. Die Clan-Mütter sind dafür verantwortlich, dass die Güter gleichmäßig verteilt werden, und das bedeutet, dass alle Clan-Mitglieder gleich viel erhalten.
Kommt es trotzdem auch mal zu Konflikten? Wie werden die gelöst? Läuft das anders als bei uns?
Klar, die im Matriarchat lebenden Menschen sind ja keine Engel. Die streiten sich natürlich auch, haben mal Probleme miteinander, oder es vertragen sich zwei Clans im Dorf nicht. Aber die Lösungen für solche Konflikte sind anders als bei uns. Wenn bei uns zwei Menschen in Streit geraten, kommt es zu seelischen Verletzungen, und die beiden Menschen sind meist allein, es hilft ihnen niemand. In matriarchalen Gesellschaften ist bei einem individuellen Streit der ganze Clan da. Und wenn Clans in Schwierigkeiten geraten, dann hilft das gesamte Dorf, die Streitigkeit zu lösen. Das bedeutet: Es ist niemand im Streit allein. Es ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe, Konflikte zu lösen. Und es geschieht stets durch Verhandlungen und Gespräche. Denn so funktioniert auch die ganze politische Entscheidungsfindung. Matriarchale Gesellschaften regieren sich selbst stets durch Verhandlungen mit dem Ziel der Konsensfindung.
Das heißt, sie leben in einer Art Konsensdemokratie?
Das ist äußerst interessant: All ihre politischen Entscheidungen fallen tatsächlich in Einstimmigkeit. Und das nicht nur im Clan, sondern im ganzen Dorf und in der Region. Das geschieht über ein sehr ausgeklügeltes System von verschiedenen Räten. Der Clan-Rat kommt zusammen, dann der Dorf-Rat und dann der Regional-Rat. Die Beratungen zeugen davon, dass die Menschen eine enorm hohe kommunikative Kompetenz haben. Sie beraten so lange, bis sich über ein Problem, das die Region betrifft, alle Menschen dieser Region einig sind. Ich habe das selbst in China miterlebt. Das funktioniert. Es ist ein politisches Muster, das von vornherein Hierarchie, Klassen, Abwertung und Mundtotmachen von anderen unterbindet. Da sind alle - auch die Minderheiten - integriert, und alle haben was zu sagen. Ich muss natürlich hinzufügen: Es sind keine Riesen-Gesellschaften wie unsere, sondern kleinere.
Welche Rolle spielt die Familie und insbesondere die Vaterschaft im matriarchalen Alltag?
Die Kleinfamilie aus Vater, Mutter, Kind, wie wir sie kennen, gibt es nicht. Die Kinder gehören grundsätzlich zur Mutter und bleiben in deren Clan. Die Mütter - das ist dann eine Gruppe von Schwestern - erziehen die Kinder gemeinsam. Großmütter, Großtanten und Brüder sind auch da. Das Interessante ist: Die Brüder betrachten die Kinder der Schwester als ihre Kinder, während die in unseren Augen biologischen Väter die Kinder nicht als ihre Kinder ansehen. Das liegt an der Mutterlinie. Der Bruder der jungen Mutter trägt denselben Clan-Namen wie sie selbst und damit auch denselben wie ihre Kinder. Daher betrachten sie sich als verwandt. Der biologische Vater aber hat einen anderen Clan-Namen, nämlich den seiner Mutter. Die Nachkommen, die er mitbetreut und für die er mitsorgt, das sind die Kinder seiner Schwestern. Das ist eine ganz andere Verwandtschaftsordnung, als wir sie haben. Die biologische Vaterschaft, wie wir sie verstehen, hat für sie keine Bedeutung. Manchmal wissen sie gar nicht, wer der biologische Vater des Kindes ist, weil es sie nicht interessiert. Falls sie es aber wissen, respektieren sie das natürlich. Denn der Mann ist ja der Geliebte der Frau. Der wird gern gesehen und bekommt Geschenke. Aber er ist nicht im Clan der Frau zu Haus.
Es gibt also keine Eheschließungen?
Nein, nicht in unserem Sinne. Es sind freie Beziehungen. Die Frauen wählen sich ihre Liebsten wie sie wollen. Da gibt es dann zum Teil kurze Beziehungen, zum Teil lange, je nachdem, wie die Liebe eben aussieht. Auch die Männer sind in ihren Liebesbeziehungen frei. Das Interessante ist, dass daraus keine sozialen Probleme für die Kinder entstehen, denn die sind ja immer im ganzen Clan zu Haus und können sich ihre Bezugspersonen aussuchen, wie sie wollen. Sie sind bestens aufgehoben.
Wie lernen die Kinder? Ist das "Learning by Doing", ein Leben lang?
Ja, genau. Die Tätigkeiten von Frauen und Männern lernen die Kinder natürlich von den Erwachsenen, und die kulturellen Angelegenheiten lernen sie durch die großen Feste. Diese Gesellschaften feiern ja sehr viele Feste. Die ganzen agrarischen Feste im Jahreskreis und ihre Lebensstadien-Feste, Ahnenfeste, das wird alles mit sehr viel künstlerischem und spirituellen Aufwand gefeiert. Die Kinder lernen die Kultur, indem sie von Anfang an teilnehmen. Das ist keine Kultur wie wir sie haben, die aus Buch, Theater etc. besteht. Wir haben eine sehr abgespaltene Kultur, die oft am Leben vorbei geht. Den matriarchalen Gesellschaften dagegen ist die Erde heilig, und damit werden die Kinder groß. Es ist eine Kultur, die ständig im Lebenszusammenhang stattfindet. Ununterbrochen.
Haben wir eine Chance, matriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft zu etablieren? Sie zeigen ja eindrücklich, dass eine Gesellschaft in Balance mit ökonomischer Gleichverteilung und politischem Konsens kein idealisierter Hokuspokus ist, sondern gelebt werden kann.
Ja, es ist lebbar. Und die Frage, was wir von diesem Wissen und diesen sehr menschenfreundlichen Mustern in unsere Gegenwart übernehmen können, wird tatsächlich immer lauter, weil mittlerweile viele Frauen und auch Männer von dieser Forschung wissen. Da muss man nicht warten, bis einzelne Staaten eine Veränderung in Gang bringen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo Menschen anfangen, in ihrem Zusammenhang matriarchal zu leben. In alternativen Bewegungen werden matriarchale Clans gegründet. In der Öko-Bewegung gibt es Menschen, die ihren anderen Umgang mit der Erde als matriarchalen Wert betrachten. In manchen Gemeinschaften probieren sie auch die Konsensfindung. Die Menschen beginnen damit von unten.
Mit Heide Göttner-Abendroth sprach Andrea Schorsch
Quelle: Wie lebt es sich im Matriarchat?
Kriterien für ein Matriarchat
Das Matriarchat ist nach ursprünglicher Definition ist eine gynozentrische Gesellschaftsstruktur, in der entweder Frauen die Macht innehaben oder die frauenzentriert ist, die Gesellschaftsordnung also um die Frauen herum organisiert ist. Ähnlich wie beim Patriarchat, bei dem es ebenso ursprünglich darum ging, dass Männer die Macht haben, ist diese Definition aber politisch umgedeutet worden, so dass ein Matriarchat nunmehr keine Machtfrage ist, sondern für davon unabhängige Strukturen steht.
Nach Heide Göttner-Abendroth gelten gegenwärtig die folgenden Kriterien für Matriarchate:
Soziale Merkmale: Die Sippen sind matrilinear strukturiert (Abstammung von der Mutterlinie) und werden durch Matrilokalität und Uxorilokalität zusammengehalten (Wohnsitz bei der Mutterlinie). Ein Matri-Clan lebt im großen Clanhaus zusammen. Biologische Vaterschaft ist neben der sozialen Vaterschaft zweitrangig. Das die Abstammung von der Mutterlinie genau so unmodern und nicht besser ist als eine Abstammung von der Vaterlinie geht dabei gerne unter. Eine moderne Gesellschaft sollte wohl einfach beide Abstammungen, die von der Mutter und dem Vater berücksichtigen. Und das solche Gesellschaften relativ starre Regeln haben, bei denen man eben in einem Clanhaus zusammenleben muss, was ich zB nicht wollte, erscheint mir auch nicht häufig thematisiert zu werden.
Politische Merkmale: Das politische System basiert auf Konsensdemokratie auf verschiedenen Ebenen (Sippenhaus, Dorf, Regional). Delegierte agieren als Kommunikationsträger zwischen den verschiedenen Ebenen. Es handelt sich um so genannte segmentäre Gesellschaften, die sich durch das Fehlen einer Zentralinstanz auszeichnen (regulierte Anarchie). Das erklärt immerhin, warum Matriarchate nicht groß werden können. Ihnen fehlt eine größere planende Instanz, die man für eine Infrastruktur und ähnliche Errungenschaften der modernen Welt braucht. Eine Autobahn zu planen ohne eine Zentralinstanz wird beispielsweise kaum möglich sein. Was das ganze allerdings mit einem Matriarchat zu tun hat erschließt sich mir nicht. Ich denke es gibt genug Frauen, die gerne mit einer zentralen Verwaltung leben und ein Repräsentationsprinzip für gut befinden. Die Behauptung, dass Anarchie gerade sehr weiblich ist, setzt eigentlich fast zwangsläufig einen Differenzfeminismus voraus und würde sicherlich in gleichheitsfeministischen theoretischen Abhandlungen abgelehnt werden müssen. Schließlich kommt es in der konstruierten Gesellschaft nur auf die Erziehung an, so dass die Vorstellung, dass Frauenstaaten anders organisiert sein müssen als Männerstaaten eigentlich inkonsequent wäre.
Ökonomische Merkmale: Es handelt sich meistens um Garten- oder Ackerbaugesellschaften. Es wird Subsistenzwirtschaft betrieben. Land und Haus sind im Besitz der Sippe und kein Privateigentum. Die Frauen haben die Kontrolle über die wesentlichen Lebensgüter. Das Ideal ist Verteilung und Ausgleich und nicht Akkumulation. Dieser Ausgleich wird durch gemeinschaftliche Feste erreicht. Es handelt sich um so genannte Ausgleichsgesellschaften. Eine Gesellschaft, die über eine Garten- und Ackerbaugesellschaft hinauskommt, bekommt damit schon einmal einen Abzugspunkt auf der Matriarchatsskala. Vielleicht ein Grund, warum „Patriarchate“ so beliebt auf der Welt sind, auch wenn Frauen mehr als die Hälfte der Wähler in freien, unabhängigen und geheimen Wahlen stellen. Denn welche Frau würde schon gerne ihre Konsumgesellschaft für eine Garten- und Ackerbaugesellschaft aufgeben? Immerhin hätte man da auch den Beleg, dass Matriarchate sexistisch sind, denn Frauen die Kontrolle über die wesentlichen Lebengüter zu geben ist zunächst einmal genau das: Sexismus. Und umgekehrt einer der beliebtesten Vorwürfe des Feminismus gegenüber dem Patriarchat. Das es dann gerecht sein soll, wenn es umgekehrt ist, dass lässt sich wohl eben auch nur mit einem Differenzfeminismus erklären, indem die Frauen besser sind als die Männer. Auch hier sollte eine Gleichheitsfeministin angewidert den Kopf schütteln, wenn sie ihre Theorie ernst nimmt und für eine Gleichberechtigung eintritt.
Weltanschauliche Merkmale: : Der Glaube, in der eigenen Sippe wiedergeboren zu werden, und der Ahnenkult bilden die Grundlage der religiösen Vorstellungen. Die Welt gilt als heilig. Die Erde als die Große Mutter garantiert die Wiedergeburt und Ernährung allen Lebens. Sie ist die eine Urgöttin, die andere Urgöttin ist die kosmische Göttin als Schöpferin des Universums. Es handelt sich um sakrale Gesellschaften. Widerliche Mutterverklärung. Das eine atheistische Gesellschaft anscheinend kein Matriarchat sein kann ist insoweit auch interessant. Auch hier scheint mir die Sichtweise nur bei einem Differenzfeminismus aufrecht zu halten zu sein. Denn ansonsten macht der hier vertreten Mutter Mythos schlicht keinen Sinn. Die Matriarchatsforschung legt damit mit ihren Kriterien einen Unterschied zwischen Mann und Frau zugrunde. Das Antje Schrupp sich damit anfreunden kann, verwundert im Prinzip nicht. Oder er ordnet positive Kriterien ohne weitere Begründung Männern und Frauen zu, was aber den Begriff Matriarchat beliebig macht. Interessant finde ich auch, dass auf den größeren feministischen Blogs, die ja allesamt keinen Differenzfeminismus vertreten, keine Kritik hierzu kommt. Interne Kritik im Feminismus ist eben unerwünscht.
Quelle: Wie lebt es sich im Matriarchat?
Interview mit Paul Sjaalmann zum Erscheinen der Trilogie
Interview mit Paul Sjaalmann
J.B. – Jutta Biesemann (Lektorin)P.S. – Paul Sjaalmann
J.B.: Warum schreibst du? Der Helbig ist dein erstes Buch – wenngleich direkt eine Trilogie. Wie kam es dazu?
P.S.: Da tust du mir zu viel Ehre an, denn die einzelnen Teile der Trilogie gab es ja vorher schon, wenn auch eher in einer Rohfassung, was besonders für Teil III gilt. Jetzt ging es darum, alles noch einmal zu überarbeiten und aufeinander abzustimmen, damit daraus auch wirklich ein Buch wird.
Und warum ich schreibe? Aus Lust an der Kreativität und auch am Formulieren. Es ist auch ein guter Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit, die doch viel von wiederkehrender Routine geprägt ist.
J.B.: Lass uns doch mal auf diese frühe Zeit deines schriftstellerischen Schaffens blicken. Was war der Auslöser, dass du angefangen hast zu schreiben?
P.S.: Ich denke, ursprünglich ging’s mir vor allem ums Verarbeiten.
J.B.: Verarbeiten wovon?
P.S.: Vor allem von Erlebnissen auf dem elterlichen Bauernhof im Rheinland, wo ich aufgewachsen bin.
J.B.: Da denkt man doch an ländliches Idyll, das Aufwachsen mit Tieren und an eine eher glückliche Kindheit …
P.S.: Das Erstaunliche ist, dass mein Bruder diese Kindheit rückblickend tatsächlich als recht glücklich wahrnimmt. Dabei war es seine Lieblingskatze, die unser Vater vor unseren Augen erschossen hat. Und auch er musste wie ich Ferkelchen halten, die ohne Betäubung mit einer Rasierklinge kastriert wurden, wodurch man danach wegen der Schreie immer ein Fiepen in den Ohren hatte. Oder helfen, wenn abends schlafende Spatzen erschossen oder am Tag deren Nester ausgerissen wurden. Nach meiner Erfahrung wird nirgends so herzlos mit Tieren umgegangen, als ausgerechnet da, wo man am meisten von ihnen umgeben ist, auf einem Bauernhof also.
J.B.: Gibt es denn gar nichts Positives, das du aus deiner Kindheit mitnimmst?
P.S. (überlegt): Vielleicht doch. Wenn man an der Reihe war mit dem Ausmisten der Kuh- und Schweineställe, musste man da alleine durch, man stand ein bis zwei Stunden in der Scheiße und musste hart arbeiten, es half alles nichts. Oder wenn man die endlosen Reihen junger Rübenpflanzen vor sich hatte, die gehackt werden wollten, musste man einfach Reihe für Reihe hacken und weiterarbeiten. Es hat mir vielleicht geholfen, dass ich gelernt habe, gegen alle Widerstände einfach weiterzumachen: beim Wegarbeiten der Korrekturstapel, bei meinen Marathonläufen und vielleicht auch beim Verfassen des einen oder anderes Kapitels des ‚Helbig‘.
J.B.: Wie ist denn aus diesen kindlichen Erfahrungen Literatur geworden?
P.S.: Indem ich pointiert und zugespitzt habe, durchaus auch mit fiktiven Ergänzungen. So weiß ich nicht mehr, ob mein Bruder nach dem tödlichen Schuss auf seine Katze den Namen seines Lieblings wirklich so gerufen hat wie in meinem Text. Auch habe ich gemerkt, dass das Weglassen ein sehr probates Mittel ist, um die Wirkung zu steigern. Herausgekommen sind Kurzgeschichten.
J.B.: Wer waren denn die ersten Leser/innen dieser Texte?
P.S.: Das waren Mitglieder der Autorenwerkstatt als Teil der Studiobühne, der ich als Student angehörte. Da haben wir reihum eigene Texte mitgebracht und zur Diskussion gestellt. Gegen Ende des Sommersemesters haben wir dann eine Anthologie mit diesen Texten herausgegeben. Von mir waren da übrigens eher Gedichte dabei, denn ich hatte damals gewissermaßen eine lyrische Phase.
J.B.: Von denen aber keines in den ‚Helbig‘ aufgenommen wurde.
P.S. (lacht): Oh nein, mit dem Abstand von mehreren Jahrzehnten zweifle ich doch etwas an der Qualität der meisten Gedichte.
J.B.: Und bei den Kurzgeschichten ist das anders?
P.S.: Ja. Ich wollte sie in den 90ern als kleinen Band herausgeben, und der Lektor eines großen Verlags hat sie in einem Telefonat auch ausdrücklich gelobt, wegen anderer Textteile wurde mein Manuskript wie auch bei anderen Verlagen jedoch abgelehnt.
Bei ‚Tableau vivants‘, dem ersten Teil des ‚Helbig‘, bot es sich dann an, die Geschichten in Form von Kindheitsrückblenden in die Handlung zu integrieren. Bei Helbig, der da in seinem Tableau unbewegt auf dem Schulhof steht, werden Erinnerungen losgetreten, zu seinen Erlebnissen als Lehrer, aber eben auch zu seiner Kindheit.
J.B.: Die ja nicht zuletzt durchs Helbigs Eltern ausgelöst werden, die am Nachmittag kommen, nachdem Helbig schon viele Stunden in zwei Tableaus gestanden hat.
P.S.: Ja, surreal lange, niemand könnte jemals so lange stehen, das weiß man, wenn man Erfahrung im Theaterspiel hat. Aber ich fand es reizvoll, während der ganzen Handlung von Teil I Helbig als ruhenden Pol einfach nur dastehen zu lassen, während sich die Handlung um ihn herum und in seinen Gedanken bzw. Erinnerungen vollzieht.
J.B.: Dabei gibt es bei Helbig viel Frustrierendes, sodass der Lehrerberuf in keinem allzu guten Licht erscheint.
P.S.: Ja, das stimmt, obwohl ich ausgesprochen gerne Lehrer bin. Eine positivistische, harmonisch-weichgespülte Darstellungsweise ist aber nun mal nicht meine Sache. Bei einer Lesung in meinem Heimatort, einer sog. Literatursession, wurde ich mal mit den Worten angekündigt: ‚Jetzt wird’s wieder schön eklig.‘
J.B.: Wozu ja auch passt, dass du am Ende auf Helbig schießen lässt, ausgerechnet von seinem Lieblingsschüler.
P.S.: Genau. Ich denke da ein wenig wie Dürrenmatt, für den eine Handlung dann zu Ende gedacht ist, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Und ursprünglich sollte es das mit dem Schuss auch gewesen sein für Helbig. Dann aber gerieten mir diese Artikel zu einem matriarchalen Gesellschaftskonzept in die Finger, so ließ ich Helbig überleben und in Sachsen einen Neustart versuchen.
J.B.: Womit wir bei Teil II, der matriarchalen Wende wären. Für wie realistisch hältst du die gesellschaftliche Umwälzung, die sich da vollzieht?
P.S.: Es kann gut sein, dass wir in absehbarer Zukunft nichts von dem sehen, was hier beschrieben wird. Wohl am ehesten, weil es nur schwer vorstellbar ist, dass die körperliche Vaterschaft bedeutungslos wird. Trotzdem hat die Entwicklung einer gesellschaftlichen Utopie in diese Richtung voll und ganz ihre Berechtigung.
J.B.: Weil? P.S.: Weil wir die Schwächen eines Beziehungsmodells auf der Basis von festen Beziehungen und Ehen tagtäglich erleben. Die Zunahme an häuslicher Gewalt, unter der ganz besonders Frauen zu leiden haben, dominiert seit geraumer Zeit die Medien. Die Gewalt steigt das achte Jahr in Folge, und an jedem dritten Tag kommt eine Frau durch einen Partner oder Ex-Partner zu Tode. Das lässt es angebracht erscheinen, Liebe und Beziehung einmal völlig neu zu denken.
J.B.: Würdest du dich als Feminist bezeichnen?
P.S.: In gewisser Weise schon. Dabei ist mir aber wichtig, dass Männer bei einer gesellschaftlichen Verschiebung in Richtung Matriarchat nichts verlieren oder abgeben, sondern dass auch sie gewinnen. In den wenigen matriarchalen Gesellschaften, die es gibt, verteidigen die Männer diese Gesellschaftsform gegen patriarchale Einflüsse von außen. Matriarchate erleben sich selbst als Gesellschaften im Gleichgewicht.
Es gibt aus meiner Sicht tatsächlich Anzeichen dafür, dass patriarchale Einflüsse abnehmen und matriarchale zunehmen.
J.B.: Was sind solche Anzeichen?
P.S.: in erster Linie eine sinkende Tendenz, die weibliche Sexualität kontrollieren zu wollen. Ich denke, dass allgemein gilt: Je patriarchaler eine Gesellschaft organisiert ist, desto ausgeprägter ist ihr Bestreben, die weibliche Sexualität zu kontrollieren.
J.B.: In diesen Kontext stellst du in deinem Buch ja auch die Ehe, die du eher schlechtmachst. Dabei bist du selbst seit mehr als 30 Jahren mit derselben Frau verheiratet…
P.S.: Und das auch noch glücklich! Dass es wie in meinem Fall auch gut gehen kann, darf doch nicht über die Schwächen dieses Modells hinwegtäuschen, das sich tendenziell selbst überfordert. Da gibt es ein lebenslanges Glücksversprechen, das eingelöst sein will, Kinder müssen erzogen werden, häufig in der stressigen ‚Nestbauphase‘, und oft genug noch gibt’s auch noch alte Eltern zu versorgen. Und wird dann mal der Hauptverdiener arbeitslos, sind existentielle Ängste vorprogrammiert. Dass sich diese ganzen Belastungen auch in Aggression entladen, liegt auf der Hand.
Hinzu kommt ein typisch patriarchaler Blick auf die Frau.
J.B.: Das heißt was?
P.S.: Das heißt, dass Partner oder Ex-Partner für Frauen auch deshalb ziemlich gefährliche Menschen sind, weil sie die Kontrolle nicht abgeben wollen, die Kontrolle über die weibliche Sexualität. Das hat ursprünglich natürlich damit zu tun, dass ein Mann mit einer Frau nur seine eigenen Gene weitergeben und etwa Haus und Hof nicht an einen Bastard vererben will. Dass diese Kontrolle über die weibliche Sexualität der Grund für die Existenz der Ehe ist, habe ich schon Anfang der 80er Jahre in einem mediävistischen Seminar gelernt. An den Schulen weiß das heute jedoch kaum jemand, Lehrkräfte inbegriffen.
J.B.: Und bei den Mosuo aus dem Südwesten Chinas, auf die du dich in Teil II des ‚Helbig‘ beziehst, ist alles ganz anders?
P.S.: Ganz genau, wobei es diese Kultur leider nicht mehr in Reinform gibt. Sie wurde aber von Göttner-Abendroth, der Begründerin der Matriarchatsforschung, hinreichend untersucht. Und Gewalt gegen Frauen ist dieser Kultur ebenso fremd wie beispielsweise Prostitution.
J.B.: Und wie muss man sich die dazugehörige Familienstruktur konkret vorstellen?
P.S. Frauen leben in Mutterhaushalten und unterhalten Besuchsbeziehungen zu Männern, mit denen sie ansonsten keine Bindung eingehen. Deswegen trägt ein Artikel darüber auch den Titel ‚Männer?! Nur für die Nacht!‘. Die Kinder, die so gezeugt werden, wachsen im Haushalt der Clan-Mutter auf, und die Brüder der Frauen betrachten die Kinder ihrer Schwestern als ihre Kinder. Denn sie tragen ja wie sie selbst denselben Clan-Namen. Diese Männer zeugen wiederum Kinder in anderen Clan-Haushalten, mit denen sie weiter nichts zu tun haben, da sie ja einem anderen Clan angehören. Das ist ein völlig anderes Verständnis von ‚Familie‘.
Die Ehe war bei den Mosuo übrigens keineswegs verboten, aber sie war selten und unbeliebt, weil sie als die unterlegene Sozialform wahrgenommen wurde.
J.B.: Warum genau?
P.S.: Vor allem, weil man es als unverantwortlich ansah, so etwas Wichtiges wie die Aufzucht von Kindern von so etwas Fragilem wie der erotischen Anziehung zwischen Mann und Frau abhängig zu machen. Außerdem liegt es auf der Hand, dass sich oben beschriebene Belastungen wie Kindererziehung, Versorgung von alten Angehörigen und Hausbau viel leichter stemmen lassen, wenn sie sich auf mehrere Schultern verteilen. Und bei Arbeitslosigkeit können andere finanziell einspringen.
J.B.: Letzteres war ja auch bei unseren früheren Großfamilien schon so.
P.S.: Das stimmt. Und es liegt ja nur wenige Generationen zurück, dass größere Familienverbände der Normalfall waren. Bei ‚Familie‘ denkt heute jeder gleich an die eheliche Kleinfamilie, dabei ist das ursprünglich die Bezeichnung für die Menschen, die unter einem Dach leben. Und da gehörten z.B. kinderlose Onkel und Tanten auch mit dazu. Die Kleinfamilie ist ja eine vergleichsweise junge Sozialform, und es sind Zweifel darüber angebracht, ob sie sich gerade historisch bewährt.
J.B.: In Teil II deines ‚Helbig‘ gibt es ja einen deutlichen Konkurrenzkampf zwischen beiden Familienkonzepten …
P.S.: Eine solche massive gesellschaftliche Umwälzung kann selbstverständlich nicht geräuschlos vonstattengehen. Und ich fand es reizvoll, Repräsentanten beider Konzepte, die ja jeweils gute Argumente haben, aufeinander prallen zu lassen, auf der Straße, im Lehrerzimmer, in Talkshows.
J.B.: Wo Helbig da steht, scheint nicht ganz eindeutig zu sein.
P.S.: Ganz bewusst nicht. Mit Maria und Corinna unterhält er ja zwei Besuchsbeziehungen zu Clan-Müttern, selbst gehört er aber keinem Clan-Haushalt an. Nach der Scheidung hängt er immer noch seiner Ex Sabine nach, was sich auch durch den ganzen dritten Teil hinzieht. Und als er einmal eine Auseinandersetzung im Lehrerzimmer mitbekommt, steht er eher auf Seiten des Verfechters des traditionellen Familienmodells.
J.B.: Du sprichst die Auseinandersetzung zwischen der Lehrerin Silke Klar und Pastor Wiemer an. Geht es da nicht eher um Fragen des Glaubens?
P.S.: Der Streit zeigt ja gerade, wie sehr der christlich-katholische Glaube und das Patriarchat miteinander verwoben sind. Indem Silke Klar als Mosuo patriarchale Strukturen ablehnt, lehnt sie auch eine Religiosität ab, die diese Strukturen stützt und verstärkt.
J.B.: Was sie dazu bringt, ihrem Pastor-Kollegen bestimmte Sakramente vorzuschlagen…
P.S.: Mit dem matriarchalen Sakrament der ‚ersten heiligen Menstruation‘ als finale Zuspitzung, was den guten Pastor natürlich auf die Palme bringt. Aber auch der Islam als noch patriarchalere Religion bekommt ja deutlich sein Fett weg.
J.B.: …indem du aus einem vermeintlichen Artikel von Silke Klar zitierst, in dem es um einen Zusammenhang zwischen der Paradiesvorstellung im Islam und der sexuellen Frustration muslimischer Männer geht. Ist das als bloße Provokation gemeint?
P.S.: Durchaus nicht. Wenn man den Mechanismus zugrunde legt, dass Menschen sich im Paradies das herbeisehnen, was sie hier auf Erden vermissen, dann hat es doch eine gewisse Aussagekraft, wenn muslimischen Männern im Paradies 72 zum Geschlechtsverkehr bereite Jungfrauen bereitstehen.
J.B.: Und warum sollen muslimische Männer sexuell frustrierter sein als z.B. christliche Männer?
P.S.: Weil sie mit dem z.T. sehr rigiden Kleinhalten der weiblichen Persönlichkeiten durch allerlei Verhaltensvorschriften und Einschränkungen auch ein Stück weit die weibliche Libido kleinhalten. Und weil Spaß im Bett immer auch der Spaß der Gegenseite bedeutet, fällt ihnen dieses Kleinhalten wieder auf die Füße, im ‚Helbig‘ heißt es, aufs Genital.
J.B.: Denkst du, dass Frauen anders auf das Buch reagieren als Männer?
P.S.: Das kann ich schlecht sagen. Es ist sicher so, dass an Stellen, in denen es um Sexuelles geht, durchdringt, dass das Buch ein Mann geschrieben hat, und da mag für einige Frauen Störendes dabei sein. Mich beruhigt aber, dass meine Lektorin recht überzeugt ist von meinem Buch.
J.B.: Es scheint, dass du in deinem Buch ein paar allgemeine Weisheiten zum Thema Glauben und zum Zusammenleben der Geschlechter an den Mann bzw. an die Frau bringen willst. In Teil III mündet das ja in eine Vielzahl von Sachtexten, die du Helbig als seinen Nachlass verfassen lässt. Ist der ‚Helbig‘ überhaupt ein `richtiger´ Roman, wie es auf dem Cover steht?
P.S.: Es stimmt, dass es in Teil III ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den Sachtextpassagen und der Helbig-Handlung gibt. Nachdem ich von mehreren Seiten das Feedback bekam, dass einige Sachtexte mit einem gewissen Widerwillen gelesen wurden, weil man gespannt war, wie es mit Helbig weitergeht, habe ich die Gewichtung verschoben. Einige Sachtextpassagen aus früheren Versionen habe ich komplett herausgenommen, andere in die Helbig-Handlung überführt und diese dann auch noch fiktiv ausgestaltet.
J.B.: Was in dem fiktiven Schluss mündet, dass Helbig nach einem kollektiven, gleichzeitigen Orgasmus die friedlichsten Momente der Menschheitsgeschichte herbeiführen will…
P.S.: Jeder Mann kennt das Gefühl von friedvoller Mattigkeit nach einem Höhepunkt, was in dem alten Hollies-Song ‚The air that I breathe‘ besungen wird. Wie beim Stehen auf dem Hof in Teil I habe ich versucht, das so zu präsentieren, dass diese friedlichsten Momente als mögliche Wirklichkeit vorstellbar werden, das gute, alte Mimesis-Prinzip eben.
J.B.: Momente, an denen Helbig selbst nicht teilhaben kann, weil er um sein Leben ringt und letzendes stirbt…
P.S.: Immerhin geht damit ein letzter sexueller Höhepunkt einher. Und ich bleibe halt der Dürrenmatt’schen Dramaturgie von der schlimmstmöglichen Wendung treu. Und in diesem Ende laufen ja verschiedene Fäden zusammen: Helbigs schlimmster Alptraum wird gewissermaßen Wirklichkeit, und nicht nur sein ehemaliger Lieblingsschüler Malte aus Teil I, sondern auch seine Tochter Lena sind auf tragische Weise in dieses Ende verstrickt.
J.B.: Abschließend noch zu deinem Pseudonym. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
P.S.: In Teil III, wo auch Helbig dieses Pseudonym annimmt, wird ja deutlich, dass es aus dem wichtigsten Werk der niederländischen Literaturgeschichte, dem ‚Max Havelaar‘ von Multatuli, stammt. Sjaalman ist da ein geschasster Kolonialbeamter, der sich erfolglos gegen die Ausbeutung der javanischen Bevölkerung auflehnt. Der ‚Helbig‘ hat auch einen sehr deutlichen, kritischen Realitätsbezug, insbesondere durch die Thematisierung von ‚Partnerschaftsmodelle‘ und ‚Glauben‘. Da Droogstoppel im ‚Max Havelaar‘ zur Feder greift und bei mir Helbig seinen Nachlass verfasst, ist die Thematisierung des Schreibens in den Romanen eine weitere Gemeinsamkeit.
J.B.: Und warum veröffentlichst du nicht unter deinem richtigen Namen?
P.S.: Ich wollte mich wohl nicht gleich so sehr mit meinen Texten exponieren. Eine gewisse Sorge um meine persönliche Sicherheit war auch im Spiel, wenn ich da an jenen Text zur sexuellen Frustration muslimischer Männer denke.
J.B.: Warum ist es ein Problem, sich mit dem, was man verfasst hat, zu exponieren?
P.S.: Wenn ich Personen aus meinem persönlichen Umfeld meine Texte zu lesen gab, stellte ich ein z.T. erschreckendes Unvermögen fest, zwischen dem Autor und seiner Hauptfigur zu unterscheiden. Nach der Lektüre von Teil II fragte mich ein guter Bekannter mal, ob ich von meiner Frau genug hätte und mir Sex mit anderen Frauen wünsche. Mich erschreckt so etwas deshalb, weil das meine Vorstellungskraft beleidigt und weil ich diese Differenzierung von jedem Mittelstufenschüler erwarte. Grundsätzlich ist erst einmal alles Fiktion, und das gilt übrigens auch für Teil I.
So ein Pseudonym bewahrt mich vielleicht vor solchen vordergründigen Rückschlüssen, sollte mein ‚Helbig‘ wirklich einmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangen.
J.B.: Ein breites Interesse für deine Romantrilogie sei dir von Herzen gewünscht.
Zum Schluss noch etwas zu deinem kreativen Prozess. Von Simone de Beauvoir und anderen Schriftsteller*innen weiß man, dass sie mehrere Stunden täglich Schreibzeit hatten. Wie organisierst du dein Schreiben?
P.S.: Ich habe mal einen Versuch gestartet, mir pro Tag zumindest mal eine Stunde Schreibzeit zu reservieren, aber das ist kläglich gescheitert. Dabei ist es vermutlich meine Schwäche, dass ich mich zu sehr vereinnahmen lasse, besonders natürlich von schulischen Dingen. Trotzdem schießen mir zwischendurch immer mal wieder Erzählideen durch den Kopf, die ich dann auf Zettel kritzele, damit ich das später ausformulieren kann. Darauf freue ich mich dann, was vermutlich auch dabei hilft, so eine Korrektur schnell durchzuziehen. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo da mehrere Stapel gleichzeitig liegen, und dann kommt über eine längere Zeit hinweg keine einzige Zeile zu Papier.
J.B.: Wie geht es nun weiter mit deiner `Schreib-Lust´? Hast du schon Ideen für einen zweiten Roman?
P.S. Erst einmal reizt es mich, den ‚Helbig‘ als Hörbuch einzusprechen.
Dann reizt mich ein Familienroman, bei dem jedes Kapitel ganz streng der Perspektive eines Familienmitglieds zugeordnet wird. Dann soll es da einen ‚Eindringling‘ geben, z.B. einen aufgenommenen Flüchtling, der einiges auf den Kopf stellt. Der Erstling von Hugo Claus ‚De Metsiers‘ ist gerade wegen dieser Erzählweise damals ausgezeichnet worden. Auch das neuere Büchlein ‚Broer‘ von Esther Gerritsen spielt in so einem familiären Kontext.
J.B.: Wir sind gespannt! Vielen Dank für das Interview.
P.S.: Sehr gerne.
Das Interview führte Jutta Biesemann mit Paul Sjaalmann am 17. Juli 2023,
eine Woche vor dem Erscheinen von ‚Helbig auf dem Hof I – III‘.
Vier schöne Träume und ein Alptraum
Ich bin ein intensiver Träumer, und habe u.a. diese aufgeschrieben.
Drei schöneTräume – auch wenn es zuerst nicht danach aussieht:
Ich fahre mit einem Wagen in den Bergen. Dabei bin ich zu schnell unterwegs, und es dauert nicht lange, da fliege ich mit meinem Auto aus der Kurve, ich durchbreche die Leitplanke und stürze in den Abgrund. Es geht wirklich sehr steil bergab. Während der Wagen stürzt und immer wieder aufschlägt, gelingt es mir, aus dem Wagen herauszukommen. Immer weiter in die Tiefe stürzend achte ich darauf, dass ich mich bei jedem Bodenkontakt gut abrolle, und das scheint zu klappen. Neben mir stürzt der Wagen, der immer mehr verbeult und zum Wrack wird. Wir stürzen weiter und weiter, bis wir endlich im Tal ankommen. Ein paar letzte Rollen, dann stehe ich auf und bemerke, dass ich völlig unverletzt bin, und das ist schier unglaublich. Ich blicke neben mich, und da liegt doch tatsächlich mein Wagen, der mit mir in die Tiefe gestürzt ist. Es ist ein zusammengedrückter metallener Quader, wie man das von Autos kennt, wenn sie gerade aus der Schrottpresse kommen. Und ich stehe daneben und bin völlig unverletzt, das ist wirklich überhaupt nicht zu fassen. Ich nehme mir fest vor, darüber in Kürze einen Zeitungsbericht zu schreiben.
(In dieser Zeit mit ca. 25 Jahren habe ich als Pressewart für einen Sportverein gearbeitet und regelmäßig Berichte geschrieben.)
In etwa zur gleichen Zeit hatte ich diesen Traum: Auf dem Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, sucht mein Vater nach mir. Er hat im Baumgarten hinter der Scheune einige riesige fleischfressende Dinosaurier, und die wollen fressen. Mein Vater will mich also unbedingt an diese Biester verfüttern. Er ruft nach mir und ist wütend, dass er mich nicht findet. Er stöbert auf dem ganzen Hof herum, aber ich bin ihm immer einen Schritt voraus. Immer wieder entkomme ich ihm und finde ein neues Versteck. Das letzte Versteck, wo er mich ganz bestimmt nicht findet, ist auf dem Heuboden über dem Kuhstall. Da kauere ich in einer Ecke unter den Heuballen, da, wo das Dach auf der Wand des Kuhstalles aufliegt. Ich bemerke einen Spalt zwischen Dach und Wand, wodurch ein Blick nach draußen freigegeben wird. Und was ich da sehe, raubt mir fast den Atem. Ich blicke in eine riesige weite Ebene und ich weiß: Dahin kannst du überall flüchten, da kannst du überall hin!
Meine Herkunftsfamilie hat mich ans Kreuz geschlagen. Das haben sie in einem Gebäude in der Nähe der Uni gemacht, wo ich studiert habe. Das Kreuz steht also in einem hohen Raum, und nun wartet meine Familie darauf, dass es mit mir zu Ende geht. Ich kann mich mit den Füßen ein wenig auf dem Sockel abstützen und mich halten, das Ganze tut weniger weh, als ich gedacht hätte. Dabei sehe ich genau, wie die Nägel in meinen Händen stecken. Weil ich nicht sterbe, wird meiner Familie die Zeit lang, deswegen gehen sie in einen kleineren Nebenraum, um dort fernzusehen oder etwas anderes zu machen. Ich hänge noch eine Weile am Kreuz, da kommt meine Schwester mit einer Lanze aus dem Nebenzimmer. Sie kommt zu mir und puhlt mir der Lanze in meiner Seite herum. Ich schreie sie von oben an: „Es ist noch zu früh! Es ist noch zu früh!“ Da lässt sie wieder von mir ab und geht wieder zu den anderen ins Nebenzimmer. Die Tür steht zwar einen Spalt offen, aber irgendwie beachten sie mich immer weniger.
So gelingt es mir nach einiger Zeit mich freizumachen und von dem Kreuz herunterzukommen. Ich stehe vor dem Kreuz und finde es ganz unglaublich, dass ich mich wirklich befreien konnte. Also schaue ich auf meine Hände, und da sehe ich Löcher in meinen beiden Handwurzeln, das Ganze muss also stimmen. Unbemerkt komme ich nach draußen und ich weiß auch, was ich jetzt am liebsten tun will: mich ganz gemütlich in ein Café in der Nähe der Uni setzen, das ich gut kenne. Dort will ich dann einfach nur dasitzen, meinen Cappuccino trinken und vielleicht noch etwas essen. Ich stehe vor dem Haus, in dem ich vom Kreuz heruntergekommen bin. Da bemerke ich auf einmal, dass ich gar kein Geld bei mir habe. Mein Portemonnaie ist noch drinnen in dem Haus, in dem meine Familie noch wartet, aber dahin will ich auf keinen Fall zurück…
(geträumt mit 55 Jahren)
Und jetzt der schönste Traum, an den ich mich erinnern kann.
Die schönsten Träume sind immer die, in denen ich fliegen kann.
Und fast immer geht es los, wie in diesem Traum:
Ich gehe in die Hocke und springe dann mit meinen kräftigen Oberschenkeln nach oben (durch den ganzen Sport habe ich da wirklich ziemlich viel Kraft). Ich schieße in die Höhe, zuerst nur einen halben Meter, dann einen ganzen und langsam immer höher. Dabei sinke ich aber nur ganz langsam wieder auf den Boden zurück, so langsam, dass ich es kaum erwarten kann, mich wieder nach oben zu katapultieren. Ich springe haushoch, turmhoch und bleibe schließlich ganz oben.
Ich fliege hoch oben mit den Wolken und genieße den Blick auf die Erde, der sich immer wieder auftut. Dabei spüre ich den Wind in meinem Gesicht und dieser Wind verlegt eine Haarsträhne vorne an meinem Kopf. Ich kenne dieses Gefühl genau, und deswegen weiß ich, dass das hier echt sein muss. Ich fliege auch einmal unten an Gebäuden entlang, komme dem Boden ganz nah, um dann wieder das befreiende Gefühl zu genießen, ganz hoch nach oben zu steigen.
So überfliege ich schließlich einen grasbewachsenen Abhang, der im Sonnenschein dort unter mir liegt. Und weil das Wetter so schön ist, sitzen da lauter Menschen, die den schönen Tag genießen. Da sitzen junge Familien mit kleinen Kindern an Picknickdecken, alte Menschen auf Klappstühlen, Pärchen, die schmusen… . Ich fliege darüber, sehe das alles und fühle mich so verbunden mit diesen Menschen, ich liebe sie so sehr, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Wieder und wieder fliege ich darüber. Schließlich fliege ich weg. Am Abend komme ich noch einmal dorthin, die Sonne steht schon sehr tief, auf dem Hügel sitzen nur noch vereinzelt Menschen, die meisten sind schon fort und andere gehen gerade. Das finde ich schade, aber nur ein bisschen.
(geträumt Anfang 2023)
Das waren, wie gesagt, schöne Träume.
Nun folgt das Kontrastprogramm, der vielleicht ärgste Alptraum, an den ich mich erinnern kann und der Eingang in den 3. Teil meines ‚Helbig‘ gefunden hat:
Der Traum ist eine Abfolge von Bildern, die wie bei einer Diavorführung gezeigt werden. Tatsächlich ist zwischen den einzelnen Bildern laut dieses typische Geräusch zu hören, das der Projektor macht, wenn das nächste Bild vom Reiter vor die Linse transportiert wird (die Älteren unter uns kennen dieses Geräusch wohl noch). Wie bei einer Diavorführung kann man nichts tun als zuzusehen. Man kann nur dasitzen und schauen.
Die Kameraeinstellung ist bei allen Bildern dieselbe. Sie zeigt die große Kreuzung, die in der Dorfmitte direkt vor unserem Bauernhof liegt.
Beim ersten Bild ist einfach nur der Asphalt auf dieser Kreuzung zu sehen.
Klick. Nächstes Bild
Beim zweiten Bild ist auffällig, dass der graue Asphalt auf dieser Kreuzung einen kleinen Hügel hat.
Klick. Nächstes Bild.
Auf dem Asphalthügel liegt ein Baby. Es liegt auf dem Rücken.
Klick.
Das Baby liegt noch an der gleichen Stelle und schreit und schreit. Warum kommt keiner?
Klick.
Das Baby liegt immer noch dort und schreit und schreit immer weiter. Aber es kommt keine Menschenseele.
Klick.
Noch immer liegt das Baby da auf dem Rücken. Es ist schon dünner geworden und schreit immer noch. Aber es ist schon etwas leiser geworden. Noch immer kommt niemand.
Klick.
Das Baby ist noch dünner und schreit nur noch schwach. Seine Haut sieht nicht mehr rosig aus, sondern an einigen Stellen schon faltig. Klick.
Das Baby hat aufgehört zu schreien. Es ist noch dünner und seine Farbe ist jetzt komplett gräulich.
Klick.
Das Baby liegt stumm da und ist so dünn, dass der Kopf an einen Totenschädel erinnert. Es ist jetzt ganz und gar grau.
Klick.
Da, wo das Baby lag, ist das Profil eines LKW-Reifens zu sehen, der mit voller Breite über das Baby gefahren ist. Es ist kein Blut zu sehen, denn das Baby hatte keines mehr.
Klick.
Das letzte Bild kommt dem zweiten gleich. Nur ist der Asphalthügel auf der Kreuzung jetzt ein wenig höher.
(geträumt mit ca. ca.27 Jahren)
Ich habe gelernt, meine Träume als eine eigenwertige Realitätsform zu begreifen, und um das zu illustrieren, gibt’s noch einen kleinen Nachschlag (geträumt 2022):
Wir unternehmen mit unserer Alt-Herren Fußballtruppe eine Radtour. Schließlich kehren wir irgendwo an einem Gasthof auf ein paar Bierchen ein, genauso, wie wir das immer machen. Ich komme etwas später in die Gaststube, und die meisten sitzen da schon an einer langen Tafel. Ich betrachte, die Reihe, die da an der Wand sitzt, und bei einem Gesicht stutze ich. Da sitzt H., und von H. weiß ich, dass er tot ist, dass er durch ein altes Eternit-Dach gebrochen ist und dass er den Sturz in die Tiefe nicht überlebt hat. An H. fällt mir auf, dass seine Gesichtsfarbe ein wenig gräulicher ist als sonst, aber da sitzt er und ist ganz der Alte. Schließlich stehen wir mit einem Bier in der Hand beisammen, er steht mir gegenüber. Ich sehe ihn an und weiß, dass H. tot ist, dass das alles hier wohl nur geträumt ist, aber doch steht er da vor mir. ‚Sei’s drum‘, denke ich, ‚das hier ist auch eine Realität‘. So freue ich mich, ihn zu sehen, nehme ihn in den Arm, und er macht seine üblichen Späße.
Drei schöneTräume – auch wenn es zuerst nicht danach aussieht:
Ich fahre mit einem Wagen in den Bergen. Dabei bin ich zu schnell unterwegs, und es dauert nicht lange, da fliege ich mit meinem Auto aus der Kurve, ich durchbreche die Leitplanke und stürze in den Abgrund. Es geht wirklich sehr steil bergab. Während der Wagen stürzt und immer wieder aufschlägt, gelingt es mir, aus dem Wagen herauszukommen. Immer weiter in die Tiefe stürzend achte ich darauf, dass ich mich bei jedem Bodenkontakt gut abrolle, und das scheint zu klappen. Neben mir stürzt der Wagen, der immer mehr verbeult und zum Wrack wird. Wir stürzen weiter und weiter, bis wir endlich im Tal ankommen. Ein paar letzte Rollen, dann stehe ich auf und bemerke, dass ich völlig unverletzt bin, und das ist schier unglaublich. Ich blicke neben mich, und da liegt doch tatsächlich mein Wagen, der mit mir in die Tiefe gestürzt ist. Es ist ein zusammengedrückter metallener Quader, wie man das von Autos kennt, wenn sie gerade aus der Schrottpresse kommen. Und ich stehe daneben und bin völlig unverletzt, das ist wirklich überhaupt nicht zu fassen. Ich nehme mir fest vor, darüber in Kürze einen Zeitungsbericht zu schreiben.
(In dieser Zeit mit ca. 25 Jahren habe ich als Pressewart für einen Sportverein gearbeitet und regelmäßig Berichte geschrieben.)
In etwa zur gleichen Zeit hatte ich diesen Traum: Auf dem Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, sucht mein Vater nach mir. Er hat im Baumgarten hinter der Scheune einige riesige fleischfressende Dinosaurier, und die wollen fressen. Mein Vater will mich also unbedingt an diese Biester verfüttern. Er ruft nach mir und ist wütend, dass er mich nicht findet. Er stöbert auf dem ganzen Hof herum, aber ich bin ihm immer einen Schritt voraus. Immer wieder entkomme ich ihm und finde ein neues Versteck. Das letzte Versteck, wo er mich ganz bestimmt nicht findet, ist auf dem Heuboden über dem Kuhstall. Da kauere ich in einer Ecke unter den Heuballen, da, wo das Dach auf der Wand des Kuhstalles aufliegt. Ich bemerke einen Spalt zwischen Dach und Wand, wodurch ein Blick nach draußen freigegeben wird. Und was ich da sehe, raubt mir fast den Atem. Ich blicke in eine riesige weite Ebene und ich weiß: Dahin kannst du überall flüchten, da kannst du überall hin!
Meine Herkunftsfamilie hat mich ans Kreuz geschlagen. Das haben sie in einem Gebäude in der Nähe der Uni gemacht, wo ich studiert habe. Das Kreuz steht also in einem hohen Raum, und nun wartet meine Familie darauf, dass es mit mir zu Ende geht. Ich kann mich mit den Füßen ein wenig auf dem Sockel abstützen und mich halten, das Ganze tut weniger weh, als ich gedacht hätte. Dabei sehe ich genau, wie die Nägel in meinen Händen stecken. Weil ich nicht sterbe, wird meiner Familie die Zeit lang, deswegen gehen sie in einen kleineren Nebenraum, um dort fernzusehen oder etwas anderes zu machen. Ich hänge noch eine Weile am Kreuz, da kommt meine Schwester mit einer Lanze aus dem Nebenzimmer. Sie kommt zu mir und puhlt mir der Lanze in meiner Seite herum. Ich schreie sie von oben an: „Es ist noch zu früh! Es ist noch zu früh!“ Da lässt sie wieder von mir ab und geht wieder zu den anderen ins Nebenzimmer. Die Tür steht zwar einen Spalt offen, aber irgendwie beachten sie mich immer weniger.
So gelingt es mir nach einiger Zeit mich freizumachen und von dem Kreuz herunterzukommen. Ich stehe vor dem Kreuz und finde es ganz unglaublich, dass ich mich wirklich befreien konnte. Also schaue ich auf meine Hände, und da sehe ich Löcher in meinen beiden Handwurzeln, das Ganze muss also stimmen. Unbemerkt komme ich nach draußen und ich weiß auch, was ich jetzt am liebsten tun will: mich ganz gemütlich in ein Café in der Nähe der Uni setzen, das ich gut kenne. Dort will ich dann einfach nur dasitzen, meinen Cappuccino trinken und vielleicht noch etwas essen. Ich stehe vor dem Haus, in dem ich vom Kreuz heruntergekommen bin. Da bemerke ich auf einmal, dass ich gar kein Geld bei mir habe. Mein Portemonnaie ist noch drinnen in dem Haus, in dem meine Familie noch wartet, aber dahin will ich auf keinen Fall zurück…
(geträumt mit 55 Jahren)
Und jetzt der schönste Traum, an den ich mich erinnern kann.
Die schönsten Träume sind immer die, in denen ich fliegen kann.
Und fast immer geht es los, wie in diesem Traum:
Ich gehe in die Hocke und springe dann mit meinen kräftigen Oberschenkeln nach oben (durch den ganzen Sport habe ich da wirklich ziemlich viel Kraft). Ich schieße in die Höhe, zuerst nur einen halben Meter, dann einen ganzen und langsam immer höher. Dabei sinke ich aber nur ganz langsam wieder auf den Boden zurück, so langsam, dass ich es kaum erwarten kann, mich wieder nach oben zu katapultieren. Ich springe haushoch, turmhoch und bleibe schließlich ganz oben.
Ich fliege hoch oben mit den Wolken und genieße den Blick auf die Erde, der sich immer wieder auftut. Dabei spüre ich den Wind in meinem Gesicht und dieser Wind verlegt eine Haarsträhne vorne an meinem Kopf. Ich kenne dieses Gefühl genau, und deswegen weiß ich, dass das hier echt sein muss. Ich fliege auch einmal unten an Gebäuden entlang, komme dem Boden ganz nah, um dann wieder das befreiende Gefühl zu genießen, ganz hoch nach oben zu steigen.
So überfliege ich schließlich einen grasbewachsenen Abhang, der im Sonnenschein dort unter mir liegt. Und weil das Wetter so schön ist, sitzen da lauter Menschen, die den schönen Tag genießen. Da sitzen junge Familien mit kleinen Kindern an Picknickdecken, alte Menschen auf Klappstühlen, Pärchen, die schmusen… . Ich fliege darüber, sehe das alles und fühle mich so verbunden mit diesen Menschen, ich liebe sie so sehr, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Wieder und wieder fliege ich darüber. Schließlich fliege ich weg. Am Abend komme ich noch einmal dorthin, die Sonne steht schon sehr tief, auf dem Hügel sitzen nur noch vereinzelt Menschen, die meisten sind schon fort und andere gehen gerade. Das finde ich schade, aber nur ein bisschen.
(geträumt Anfang 2023)
Das waren, wie gesagt, schöne Träume.
Nun folgt das Kontrastprogramm, der vielleicht ärgste Alptraum, an den ich mich erinnern kann und der Eingang in den 3. Teil meines ‚Helbig‘ gefunden hat:
Der Traum ist eine Abfolge von Bildern, die wie bei einer Diavorführung gezeigt werden. Tatsächlich ist zwischen den einzelnen Bildern laut dieses typische Geräusch zu hören, das der Projektor macht, wenn das nächste Bild vom Reiter vor die Linse transportiert wird (die Älteren unter uns kennen dieses Geräusch wohl noch). Wie bei einer Diavorführung kann man nichts tun als zuzusehen. Man kann nur dasitzen und schauen.
Die Kameraeinstellung ist bei allen Bildern dieselbe. Sie zeigt die große Kreuzung, die in der Dorfmitte direkt vor unserem Bauernhof liegt.
Beim ersten Bild ist einfach nur der Asphalt auf dieser Kreuzung zu sehen.
Klick. Nächstes Bild
Beim zweiten Bild ist auffällig, dass der graue Asphalt auf dieser Kreuzung einen kleinen Hügel hat.
Klick. Nächstes Bild.
Auf dem Asphalthügel liegt ein Baby. Es liegt auf dem Rücken.
Klick.
Das Baby liegt noch an der gleichen Stelle und schreit und schreit. Warum kommt keiner?
Klick.
Das Baby liegt immer noch dort und schreit und schreit immer weiter. Aber es kommt keine Menschenseele.
Klick.
Noch immer liegt das Baby da auf dem Rücken. Es ist schon dünner geworden und schreit immer noch. Aber es ist schon etwas leiser geworden. Noch immer kommt niemand.
Klick.
Das Baby ist noch dünner und schreit nur noch schwach. Seine Haut sieht nicht mehr rosig aus, sondern an einigen Stellen schon faltig. Klick.
Das Baby hat aufgehört zu schreien. Es ist noch dünner und seine Farbe ist jetzt komplett gräulich.
Klick.
Das Baby liegt stumm da und ist so dünn, dass der Kopf an einen Totenschädel erinnert. Es ist jetzt ganz und gar grau.
Klick.
Da, wo das Baby lag, ist das Profil eines LKW-Reifens zu sehen, der mit voller Breite über das Baby gefahren ist. Es ist kein Blut zu sehen, denn das Baby hatte keines mehr.
Klick.
Das letzte Bild kommt dem zweiten gleich. Nur ist der Asphalthügel auf der Kreuzung jetzt ein wenig höher.
(geträumt mit ca. ca.27 Jahren)
Ich habe gelernt, meine Träume als eine eigenwertige Realitätsform zu begreifen, und um das zu illustrieren, gibt’s noch einen kleinen Nachschlag (geträumt 2022):
Wir unternehmen mit unserer Alt-Herren Fußballtruppe eine Radtour. Schließlich kehren wir irgendwo an einem Gasthof auf ein paar Bierchen ein, genauso, wie wir das immer machen. Ich komme etwas später in die Gaststube, und die meisten sitzen da schon an einer langen Tafel. Ich betrachte, die Reihe, die da an der Wand sitzt, und bei einem Gesicht stutze ich. Da sitzt H., und von H. weiß ich, dass er tot ist, dass er durch ein altes Eternit-Dach gebrochen ist und dass er den Sturz in die Tiefe nicht überlebt hat. An H. fällt mir auf, dass seine Gesichtsfarbe ein wenig gräulicher ist als sonst, aber da sitzt er und ist ganz der Alte. Schließlich stehen wir mit einem Bier in der Hand beisammen, er steht mir gegenüber. Ich sehe ihn an und weiß, dass H. tot ist, dass das alles hier wohl nur geträumt ist, aber doch steht er da vor mir. ‚Sei’s drum‘, denke ich, ‚das hier ist auch eine Realität‘. So freue ich mich, ihn zu sehen, nehme ihn in den Arm, und er macht seine üblichen Späße.
Mal ein Gedicht
Auf Papier
Damals,als nicht in Goodnotes geschrieben wurde,
sondern auf Papier:
Damals gab’s Streit.
Ein Stapel leerer, unbeschriebener Blätter
liegt herum,
unnütz, wertlos, stört die Ordnung.
Weg damit
ins Altpapier,
einfach so.
Weiße Blätter,
die man beschreiben könnte,
von beiden Seiten
mit Einfällen, mit Ideen, mit kostbaren Gedanken.
Wie könnt ihr nur?!
Schnell nimmt er seiner Mutter
das Papier aus der Hand.
Nun geh schon,
nenn mich einen Geizkragen womöglich.
Dann such ich sie auf,
die geheime Schublade,
die die Bögen aufnimmt,
Bögen,
die später einmal
Schätze tragen werden,
womöglich.
Dez. 2022