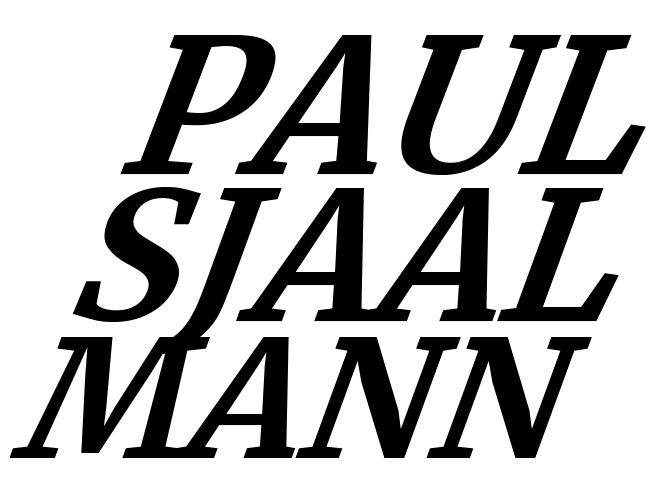Leseprobe zu Teil III ‚Benediktushof‘
Helbig ist bemüht, sich als ehemaliger Kunsterzieher in die Gemeinschaft der Senioren am Benediktushof einzubringen und veranstaltet einen Zeichenkurs
Das Leben zu akzeptieren, bedeutete hier am Benediktushof, sich auch einmal etwas in die hier lebende Gemeinschaft einzubringen. So leiteten noch rüstige Bewohner/innen entsprechend ihren Fähigkeiten unterschiedliche Gruppen, in denen z.B. geklöppelt, geschnitzt und sogar auch jongliert wurde. Helbig fühlte sich sehr an das pädagogische Prinzip erinnert, die Schüler doch das machen zu lassen, was sie können. Und was konnte Helbig? So einiges, er war schließlich Kunstlehrer.
Er entschied sich für die Gestaltung von kreativen Portraits, einer der wenigen Fortbildungsinhalte, die bei Helbig den Schritt in die Umsetzung mit seinen Schülern geschafft hatte.
Mit zehn Teilnehmenden war seine Gruppe zufriedenstellend besucht. Anscheinend hatte seine Ankündigung auf dem Aushang ‚Kunst schaffen, ohne hinzuschauen‘ hie und da für Neugierde gesorgt. So saßen sie jetzt erwartungsfroh vor ihm und das war doch etwas ganz anderes, als so eine nölige Mittelstufenklasse vor sich zu haben. Auch Isabelle und Hedwig waren dabei und sogar der Nix, der hier sicher den Klassenclown abgeben würde mit seinen Kommentaren. Noch hielt er sich bedeckt. Alle waren mit einem großen Blatt und einem dicken Stift ausgestattet, und jetzt galt es zunächst einmal zu entscheiden, wer denn eigentlich porträtiert werden sollte. Da gab es alle Möglichkeiten, denn nicht umsonst hatte Helbig für diese Aktion einen Raum mit einem großen Smartboard-Bildschirm ausgewählt. Im Netz konnte man unter ‚Portrait/Bilder‘ alle möglichen Gesichter aufrufen, die durchweg sehr ansehnlich waren. Helbig schlug das eine oder andere Gesicht vor, aber aus der Gruppe kam wenig Resonanz.
Jemanden, den wir kennen.
Helbig schossen spontan die Gesäß-Portraits von diesem Referendar an seiner letzten Schule durch den Kopf, aber, zum Glück, hier ging’s ja nur um Gesichter.
Ja, die Schöppgens.
Warum eigentlich nicht? Helbig öffnete die Homepage des Benediktushofes, auf der natürlich die Leiterin mit Bild zu sehen war. Er machte einen Screenshot, schnitt das Portraitbild aus und brachte es auf die erforderliche Größe.
Jetzt galt es, ganz genau seinen Anweisungen zu folgen. Noch einmal Lehrer spielen, und wie wohltuend war es, all die erwartungsfrohen Blicke auf sich gerichtet zu sehen.
Den dicken Stift nehmen und damit in der Luft die Konturen des Schöppgens-Portraits abfahren, gerade so, als wolle man es nachzeichnen, ohne den Stift abzusetzen. Auch nicht bei der Augenpartie, die immer besondere Aufmerksamkeit verdienen. Das Ganze drei Mal, immer den Blick nach vorn auf das Portrait gerichtet und den Stift in der Luft.
Und jetzt wird Kunst produziert, ohne hinzuschauen. Der Stift wird auf das Blatt gesetzt. Und wie bei den drei Malen zuvor fährt er die Umrisse des Portraits ab, ohne abzusetzen. Dabei bleibt der Blick die ganze Zeit nach vorne auf das Portrait gerichtet. Wie vorhin: Die Augen verdienen besondere Aufmerksamkeit.
Helbig sieht und hört, wie vor ihm die Stifte über die Blätter wandern.
Und er erinnerte sich an Schülerblicke, die doch unwillkürlich nach unten wanderten damals, hier war es nur der Nix, den Helbig einmal ermahnen musste.
Und die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen, auch wenn einige Künstler selbst eher zweifelnd dreinschauten. Wie früher ging Helbig durch die Reihen, äußerte sich würdigend, anerkennend, verwies auf gelungene Details. Die Schöppgens war zwar fast nirgends zu erkennen, aber die oft picassohaft versetzten Augen machten großen Eindruck. Das Werk einer Berit Eickelshoven, die Helbig bisher nur von ein paar belanglosen Gesprächen bei den Spaziergängen her kannte, hob sich besonders ab. Eine besonders markante Augenpartie, sichere Linienführung, und die Leiterin der Einrichtung blieb erkennbar.
Helbig nahm sich vor, Berit später einmal um Erlaubnis zu fragen, Frau Schöppgens das Bild zu zeigen. Jetzt wollte er sie nicht vor den anderen so hervorheben. So endete Helbigs erste Kunststunde seit zehn Jahren mit einem anerkennenden Tischklopfen.
Oben auf seinem Zimmer hatte er dennoch das Gefühl, dass er sich da auf etwas eingelassen hatte, was definitiv hinter ihm lag. Er hatte sich gar nicht so unwohl gefühlt, da vorhin mit seinen Mitbewohnern, jetzt im Nachhinein fühlte es sich eher falsch an.
Helbig bespricht in der Cafeteria des Benediktushofs einen weiteren religionskritischen Text mit Isabelle und Hedwig, zu denen sich eine Freundschaft entwickelt hat.
Das hielt den Nix und noch drei weitere Seniorinnen an einer benachbarten Tischgruppe nicht davon ab, sich gleichfalls zu ihnen zu gesellen. Herdentrieb, was Wunder. In diesem tagtäglichen Einerlei war jede kleine Abwechslung willkommen.
Und Hedwig wie auch Isabelle schienen sich berufen zu fühlen, die neu Hinzugekommenen ins Bild zu setzen. Und schon entspann sich eine muntere Diskussion, die mit der Erbsünde und dem guten oder bösen Wesen des Menschen kaum noch mit Helbigs Texten zu tun hatte. Sollte ihm recht sein.
Auch die Leiterin Sieglinde Schöppgens war aufmerksam geworden und blickte zunächst interessiert und freundlich in die Runde. Das änderte sich aber, nachdem Hedwig Helbigs Gedanken indirekt wiedergegeben hatte, wonach Gott wie der Teufel ein für alle Mal im Mottenschrank der Geschichte zu verschwinden hätten. Die Schöppgens zog die Stirn kraus und schüttelte leicht den Kopf.
Am nächsten Tag saß Helbig bei ihr im Büro.
Lieber Herr Helbig, wir alle hier schätzen Sie als gebildeten und kreativen Mitbewohner.
Sie zeigte auf das Portrait von Berit Eickelshoven, das ihr so gut gefallen hatte, dass es jetzt bei ihr im Büro hing.
Es wäre doch schön, wenn Sie an solche gelungenen Aktionen anknüpfen würden, anstatt unsere Bewohner zu verunsichern, indem Sie Zweifel an der Existenz Gottes säen.
Wenn diese Zweifel aber nun mal berechtigt sind?
Dass sagen Sie, dass diese Zweifel berechtigt sind. Für mich und für viele hier ist die Existenz Gottes eine unumstößliche Wahrheit.
Eine Wahrheit, die nur in Ihrem Kopf existiert. So wie in den -zig Generationen vor uns andere Gottes-Wahrheiten in den Köpfen der Menschen existierten. Aber in dem Moment, in dem diese Gottesvorstellungen ausgestorben waren, waren auch diese Götter nicht mehr existent. Nehmen Sie Zeus, nehmen Sie Odin, Jupiter, Apollo…
Helbig zögerte und wollte noch diesen blutrünstigen Gott der Azteken anführen, aber dieser Name war wirklich zu unaussprechlich.
Sie alle liegen auf dem Friedhof der Geschichte. Sie existieren schlicht und ergreifend nicht mehr, weil keiner mehr an sie glaubt. Und nichts deutet darauf hin, dass es Ihrem christlichen Gott besser ergehen sollte.
Immerhin hält er sich schon rund 2000 Jahre.
Weil die Welt in dieser Zeit humaner und toleranter geworden ist. Aber ist das ein ernstzunehmender Hinweis auf faktische Existenz?
Die Schöppgens merkte, dass sie hier nicht weiterkam und schlug einen versöhnlichen Ton an. Am Benediktushof könne selbstverständlich jeder glauben, was er oder sie wolle. Sie wünsche jedoch nicht, dass den Menschen hier, deren Zeit auf Erden sich dem Ende zuneige, in Anbetracht dieses Endes die Hoffnung genommen werde. Viele hier hätten einfach im Glauben Zeit ihres Lebens einen festen Halt und eine Orientierung gefunden. Wie bei einem Kompass hätten sie ihr Leben nach Gott ausgerichtet, und daran sei ja wohl nichts Verwerfliches. Sie schloss ihre kleine Standpauke mit einem Verweis auf den Ort, an dem sie lebten, an dem auch Helbig lebte. Und dieser Ort sei benannt nach dem heiligen Benediktus.
[…]
Auf dem Weg zum Mittagstisch kamen Helbig drei Frauen mit Kopftuch entgegen und eine mit Schador, Angehörige von Bewohnern anscheinend, die jetzt zur Mittagszeit nach Hause gingen. Auf dem gleichen Weg wurde Helbig von zwei jungen Frauen überholt, die im Vergleich dazu beinahe nackt wirkten. Zwar war Deutschland noch weit von Zuständen entfernt, wie Michel Houellebecq sie in seinem Roman ‚Unterwerfung‘ beschrieben hatte, doch wurde der Islam durch sich bedeckende Frauen rein optisch immer präsenter. Die höhere Reproduktionsquote der Muslime in Deutschland zeigte Wirkung, und viele trugen Kopftuch oder Schador. Waren das alles konservativ Gläubige, möglicherweise sogar unter dem Eindruck des Zusammenschlusses von Taliban und IS im letzten Jahr? An den vielen heißen Tagen während der Trockenzeit sah man immer häufiger ein skurriles Nebeneinander von sich bedeckenden Frauen in langen, wehenden Gewändern und solchen in Hot Pants mit halb frei liegenden Pobacken und bauchfreien Tops.
Beim Mittagessen mit Isabelle und Hedwig war Helbig ziemlich schweigsam, nachdem er wenig überzeugend seine Komplimente vorgebracht hatte. Was den beiden natürlich prompt auffiel.
Aha, unser großer Autor brütet wieder etwas aus.
Ausbrüten stimmte, Ironie war er von den beiden ja gewohnt. Am Nachmittag schrieb er das nächste Kapitel.
Blöße und Nacktheit
Nicht nur in überwiegend muslimischen Ländern, auch hierzulande ist zu beobachten, dass sich immer mehr Frauen in der Öffentlichkeit bedecken. Dieser Vorschrift des Korans kommen die meisten Frauen mit einem Kopftuch nach, gelegentlich auch mit einem zusätzlichen langen Gewand, das bis zum Boden fällt und die Körperrundungen verhüllt, dem Schador. Nikab und besonders Burka bleiben in Europa seltene Kuriositäten.
Die Motive von Frauen, sich zu bedecken, sind vielschichtig und gehen über das Gebot des Korans hinaus. So wollen insbesondere junge Mädchen ihre Gruppenzugehörigkeit demonstrieren, andere wollen provozieren, und möglicherweise liegt in diesem Verhalten auch ein gewisses Maß an weiblicher Berechnung.
Zunächst sei an den ursprünglichen, quasi offiziellen Sinn dieser Kleidervorschrift erinnert, dass Männer sich nämlich nicht den optischen weiblichen Reizen ausgesetzt sehen, was es leichter macht, sich auf Gott zu konzentrieren. Außerdem wird ein Beitrag zu einem friedvollen Zusammenleben angenommen, indem Männer nicht zu unerwünschtem, übergriffigem Verhalten gegenüber Frauen verleitet werden.
Folgt man dieser Logik müsste es da, wo Frauen wenig oder sogar gar nicht bekleidet sind, ein großes Problem mit männlichen Übergriffen geben. Auffällig ist es jedoch, dass die riesigen öffentlichen Wellness- und Sauna-Anlagen für die vielen tausend splitternackten und inmitten von Männern herumlaufenden Frauen ziemlich sichere Orte sind. Auch in der guten alten FKK-Bewegung hatten Frauen aufgrund ihrer Nacktheit von den Männern nichts zu befürchten. Und die Männer mussten und müssen sich da gar nichts verkneifen: Würde so viel weibliche Nacktheit sie erregen, wäre das an ihrem Ständer ja leicht zu erkennen, da sie gleichfalls nackt sind. Nackte Frauen, auch wenn sie gut aussehen, lassen Männer in nicht sexuellen Situationen also ziemlich kalt - zum Glück.
Dem muslimischen Verhüllungsgebot liegt also zunächst einmal ein etwas realitätsferner und zudem männerfeindlicher Blick auf die männliche Sexualität zugrunde.
Seit vielen Jahren wird die männliche Wahrnehmung jedoch mit unendlich vielen sexuellen Reizen ‚gefüttert‘, und dazu müssen nicht einmal Pornos im Netz konsumiert werden. Auf Werbeplakaten sind überlebensgroß weitgehend nackte Frauen in Unterwäsche zu sehen, und ein nackter Busen oder angedeutete Sexszenen im normalen Fernsehprogramm regen schon lange niemanden mehr auf. Folgt man nun dem bekannten Reiz-Reaktionsdenken, müsste das zu einem sprunghaften Anstieg der Sexualkontakte führen, die von Männern initiiert werden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, Männer ziehen sich in einem Maße sexuell zurück, dass es ganz danach aussieht, als würden die allgegenwärtigen weiblichen Reize den sexuellen Appetit der Männer nicht erhöhen, sondern schwinden lassen.
Wenn es nun aber so ist, dass die übermäßige Konfrontation der Männer mit weiblichen Reizen zu weniger und nicht zu mehr sexueller Aktivität führen, dann lässt sich auch das Verhüllen der Frauen anders deuten. Das männliche Verhalten legt zumindest nahe, dass Frauen, wollten sie sich wirklich vor sexuellen Übergriffen schützen, besser daran täten, sich splitternackt auszuziehen, anstatt sich zu bedecken. Und der Autor steht sicher nicht mit seiner Einschätzung allein da, dass ein gut angezogener weiblicher Körper mehr Attraktivität ausstrahlt als ein nackter. Ein sichtbar getragener Reißverschluss an einem gut geformten weiblichen Hintern weckt immer die Fantasie, diesen aufzuziehen und danach genüsslich weiterzumachen. Völlige Nacktheit hat dagegen schnell etwas Ernüchterndes, und die eine oder andere Orangenhaut-Delle, die sich da zeigen mag, ist da ganz nebensächlich.
Man könnte meinen, Frauen, die sich bedecken, kennen uns Männer wieder einmal besser, als wir es selbst tun, und vielleicht liegt im islamischen Verhüllungsgebot ja mehr Weisheit als gedacht. Dann nämlich, wenn die weiblichen Rundungen unter einem Schador erahnt werden wollen, wenn die Augen, die einem aus dem Nikab-Schlitz entgegenblitzen, auf das verborgene zugehörige Gesicht neugierig machen. Und erst recht auf den Körper, der ja nur zu erahnen ist.
Schade nur, dass sich diese Neugierde in Anbetracht der allgegenwärtig zu Schau gestellten Rundungen und Reize nicht recht einstellen mag. Damit sind wir wieder beim grotesk anmutenden Nebeneinander von Bedeckung und Nacktheit an heißen Tagen. Das Tragen von Burkinis ist bei den immer zahlreicheren muslimischen Frauen und Mädchen weit verbreitet, und nach einigen Aufregern vor 20 Jahren an der französischen Côte d’Azur oder in öffentlichen Bädern nimmt niemand mehr Anstoß daran. Auf der anderen Seite hat sich das String-Höschen, das die Pobacken freilegt, bei Frauen und Mädchen, die sich das halbwegs erlauben können, auch weitgehend durchgesetzt. Ein Oberteil wird oft nicht mehr für nötig befunden, was auch außerhalb des Englischen Gartens in München niemanden mehr kümmert. Oben-Ohne-Demos von feministischen Aktivistinnen hatten Wirkung hinterlassen und Nachahmerinnen gefunden. Wie geheimnisvoll ist aber ein verhüllter Frauenkörper noch, wenn sich ein Handtuch weiter ein solcher Körper fast gänzlich entblößt präsentiert? Und natürlich beschäftigt es die Fantasie eines Mannes eher, den Stringtanga herunter- oder den besagten Reißverschluss aufziehen, als einen nur möglicherweise attraktiven Frauenkörper in einem weiten Gewand zu erahnen.
So muss der Versuch, durch Bedeckung zumindest etwas von dem aufreizenden Mysterium des Weiblichen bewahren zu wollen, in Anbetracht der gleichzeitig bloßgelegten weiblichen Tatsachen hilflos und auch ein wenig verzweifelt erscheinen. Vielleicht wird aber gerade so der eingangs angenommene Zweck des muslimischen Verhüllungsgebots, dass sich Männer von bedeckten Frauen fernhalten, unfreiwillig erreicht.
Helbig kommt in einem seiner Sachtexte auf den alten Hollies-Song ‚The air that I breathe‘, der die friedvolle Mattigkeit eines Mannes nach einem Höhepunkt beschreibt.
‘If I could make a wish, I think, I’d pass. Can’t think of anything I need.’
Einige Male hatte er sie auch hier erlebt, diese tiefe wunschlose Zufriedenheit, die sich einstellte, nachdem er mit einer Frau geschlafen hatte – und zum Höhepunkt gekommen war, musste man jetzt ergänzen. Wie wohlig und matt er sich da gefühlt hatte.
Making love with you has left me peaceful, warm and tired. What more could I ask, there’s nothing left to be desired.’
Und mit einem Mal wurde ihm bewusst, dass da ein gewisses sozial-utopisches Potential in diesem Song steckte. Nichts mehr wünschen, nichts mehr wollen, als Mann nur schwer und befriedigt daliegen. Als Mann. Es war ja noch immer so, dass fast ausschließlich Männer auf der ganzen Welt aggressiv-destruktive Konflikte anzettelten. Aber das friedenbringende Potential der männlichen Refraktärzeit hatte bislang anscheinend niemand auf dem Zettel gehabt. Was sprach dagegen, diesen friedvollen Zustand bei Männern in den Minuten danach zum Wohle der Menschheit zu nutzen? Was vielleicht in der Prähistorie bereits geschehen war. Wer weiß, vielleicht schliefen Frauen da ja vor allem mit ihren Männern, um sie davon abzuhalten, sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Möglicherweise war das die Geburtsstunde von ‚Make love, not war‘. Und wieviel Leid hatte Gewalt von Männern in den folgenden Jahrtausenden nicht schon über die Menschheit gebracht? Wurde es da nicht allerhöchste Zeit, das friedenbringende Potential der männlichen Refraktärzeit zu nutzen? Zugegeben, einen Putin hätte das damals kaum davon abhalten können, die Ukraine zu überfallen. Da hätte man schon Wege finden müssen, ihn in einen Zustand langanhaltender Refraktärzeit zu versetzen. Auf den wenigen Bildern, die nach außen drangen, wirkte er nach all den Jahren so, als wäre genau das eingetreten: ein komatös dreinschauender alter Mann in seiner Zelle in Den Haag, wo der internationale Haftbefehl gegen ihn vollstreckt wurde. Sein kraftloser Zustand war jedoch keiner Refraktärzeit, sondern vor allem den starken Krebsmedikamenten geschuldet, die er regelmäßig einnahm.
Auch, wenn auf lange Sicht das große Leid, das sein Ukraine-Krieg und die noch folgenden Kriege heraufbeschworen hatten, nicht verhindert würde, könnte es doch einmal eine Oase des Friedens inmitten all dieser Auseinandersetzungen geben. Ein paar Minuten nur, in denen Männer auf der ganzen Welt nur das hier fühlten:
‘Peace came upon me and it leaves me weak.’
Da konnte man durchaus auch bei den Frauen ansetzen, die seit Menschengedenken unter den kriegerischen Aggressionen ihrer Männer zu leiden hatten. Man könnte sich die sozialen Medien zunutze machen, in denen Frauen gerade auf der ganzen Welt gut erreichbar waren. Helbig stellte sich vor, dass auf diesem Weg weltweit eine bestimmte Zeit vereinbart wurde, zu der Frauen mit ihren Männern, oder mit welchen Männern auch immer, Sex haben. Bei dem leichten Frauenüberschuss, den es weltweit gab, sollte jeder Mann eine Frau abbekommen. Ziel war es, die Männer zu einer bestimmten Zeit möglichst minutengenau zum Höhepunkt zu bringen.
Sollte dies gelingen, würden die Minuten, die dann folgten, als die friedvollsten in die Geschichte der Menschheit eingehen:
‚Peace came upon me‘ millionen-, milliardenfach.
Warum das nicht einfach mal versuchen, hier vom Benediktushof aus? Was konnte er schon verlieren? Helbig nahm sich vor, in einigen sozialen Medien die Idee mal zur Sprache zu bringen und die Resonanz zu prüfen.
[…]
Bevor er sich ans Schlusswort machte, verfolgte Helbig als P. Sjaalmann noch einen Teil der Kommunikation in den sozialen Netzwerken zu seiner Initiative ‚Die friedlichsten Minuten der Menschheitsgeschichte‘. Alles war nicht mehr zu verfolgen, dafür war die Sache inzwischen zu groß geworden. Sogar in den öffentlich-rechtlichen Medien war die Idee inzwischen angekommen, weswegen da auch in letzter Zeit häufiger der alte Hollies-Song zu hören war. Und mit Genugtuung und auch ein wenig Stolz registrierte Helbig das Rätselraten um das Pseudonym Paul Sjaalmann.
Doch es gab bei weitem nicht nur Befürworter, und wieder einmal führten hier vor allem Frauen das Wort. Das ging schon beim Hollies-Song los, der doch in erster Linie ein Liebeslied war. Demnach gelte ‚Peace came upon me and leaves me weak‘ nur, wenn der Mann, der da gerade einen Höhepunkt erlebt hatte, auch in einer Liebesbeziehung stünde. Andere entgegneten, dass sie einen derartigen Zustand bei Männern nach dem Orgasmus immer beobachteten, auch dann, wenn sie beide einfach nur geil und nicht verliebt gewesen waren. Man empfahl der Liebes-Fraktion dann eben eine solche intensive Beziehung anzubahnen, ganz im Sinne von Make love, not war. Schließlich habe man selbst ja auch etwas davon.
Aus feministischen Kreisen wurde, wie zu erwarten war, die Instrumentalisierung des Geschlechtsaktes kritisiert. Sollten Frauen vögeln, nur um so ein fiktives, abstraktes Ziel wie diesen friedlichsten Moment der Menschheitsgeschichte zu erreichen? Ob das nicht eigentlich schon an Prostitution grenze. Dem wurde entgegengehalten, dass Frauen sich Männer aussuchen sollten, mit denen das nicht so war, solche, die ihnen selbst auch etwas gaben. Außerdem sei unstrittig, dass Frauen aus allen möglichen Gründen mit Männern schliefen: aus Liebe, aus Vergeltung, aus Selbstbestätigung, aus Geltungssucht, für Geld. Da könnten sie es doch auch einmal tun, um etwas zu diesem menschheitsgeschichtlich bedeutsamen Moment beizutragen. P. Sjaalmann wurde mehrfach gedrängt, das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der friedlichsten Minuten der Menschheitsgeschichte endlich festzulegen, und schließlich kam Helbig dieser Bitte nach. Unter Berücksichtigung der Zeit, die es für die Anbahnung der einen oder anderen Beziehung noch brauche, bestimmte Helbig den Samstagabend um 21 Uhr in drei Wochen. Bei einem noch längeren Abstand stand zu befürchten, dass das Interesse an der Aktion erlahmte.
Zu jenen Momenten, bei deren Dauer es, gemessen an der durchschnittlichen männlichen Refraktärzeit, um rund 20 Minuten ging, tauchten weitere Fragen auf: Wurde das auf irgendeine Art dokumentiert oder gemeldet? Wo konnte man eingeben, dass man teilgenommen hatte?
Helbig wurde etwas schwindlig bei dem, was er da losgetreten hatte und was es noch alles zu klären galt.
Und es wurde klar, dass man zum Gelingen der Aktion auch bestimmte Sexualgewohnheiten von Paaren thematisieren musste. So wurde folgende Empfehlung gegeben:
Damit die Männer nach 21 Uhr auch wirklich die friedvolle Refraktärzeit mit ihren Partnerinnen genießen können und nicht etwa noch mit deren Befriedigung beschäftigt sind, wird den Männern empfohlen, vorab für den Orgasmus der Frauen zu sorgen, am praktischsten mit klitoraler Stimulation.
[…]
Es war die einhellige Meinung in den Frauen-Foren, dass sich die Herren an dem besagten Abend gehörig Zeit lassen und ihre Finger erst einmal von den empfindlichsten Stellen des weiblichen Körpers fernhalten sollten. Munter wurden Vorschläge ausgetauscht, wie die Stunden vor den entscheidenden Minuten gestaltet werden konnten. Tango oder Salsa-Tanzen und Sauna-Besuche standen hoch im Kurs. Wie auch gemeinsam zu kochen und zu essen, um die Sinne schon einmal anzuregen. Gleich mehrere Frauen meldeten sich daraufhin zu Wort, dass, wenn vorher gemeinsam gekocht würde, die Männer auf keinen Fall Chili-Schoten schneiden oder mit scharfen Gewürzen hantieren sollten. Darauf, dass sie sich danach gründlich die Hände wuschen, könne man sich sowieso nicht verlassen. Da hatten einige Damen wohl unangenehme Erfahrungen gemacht.
Von mehreren Seiten kam der Vorschlag, vor dem besagten Abend eine gewisse Zeit enthaltsam zu leben, um dann die Erfüllung des sexuellen Verlangens umso intensiver zu genießen. Eine gewissen Zeit schon, aber Vorsicht, nicht zu lange, use it or loose it, eine Woche bis zehn Tage vorherige Enthaltsamkeit hielten die meisten für angemessen. Frauen fanden, dass kleine Aufmerksamkeiten und leichte, wie zufällige Berührungen während dieser Zeit die Vorfreude auf den besagten Abend noch zu steigern und die sexuelle Erfüllung noch zu intensivieren vermochten.
Helbig fiel auf, dass sich in den betreffenden Foren die Männer, um die es ja letztendlich ging, sehr zurückhielten. Einige mussten sogar von ihren Partnerinnen überredet werden, an der Aktion teilzunehmen. Das ließ Skepsis aufkommen, ob die Männer auch wirklich in der anvisierten Größenordnung dabei waren. Aber von weiblicher Seite kam einhellige Entwarnung. Alles im grünen Bereich, sie hätten da schließlich ihre Mittel und Wege. Alles im Griff.
Bei der Frage, was denn die Paare nach dem Akt, also während dieser Minuten, auf die es ja ankam, tun sollten, setzte sich zu Helbigs Erleichterung eine Meinung durch, die für ihn mit keinerlei Aufwand oder Arbeit verbunden war:
Man sollte einfach nur erschöpft und befriedigt daliegen und das Gefühl genießen, dass man jetzt mit Millionen anderen, die in diesem Moment ganz ähnlich fühlten, diese menschheitsgeschichtlich bedeutsamen Minuten erleben durfte. Minuten, in denen man von Erhabenheit, Dankbarkeit und völliger Ambitionslosigkeit erfüllt war - ‚nothing left to be desired‘ -, einfach das Gefühl genießen, dass man von den abertausenden Generationen des Menschheitsgeschlechts ausgerechnet zu der Generation gehörte, die diesen glücklichsten und friedlichsten Moment der Menschheitsgeschichte erleben durfte. Und dass man selbst durch sein eigenes liebevolles Handeln dazu seinen persönlichen Beitrag geleistet hatte. Den getragenen Hollies-Song fanden einige für diese Minuten sehr passend, anderen war er zu lahm oder zu kitschig. Schließlich fand es noch allgemeine Zustimmung, weltweit zehn Minuten später, also an jenem Samstag um 21:30 Uhr kollektiv anzustoßen, am besten mit Sekt, der allerdings nicht in allen Teilen der Welt verfügbar war. Bei diesem Thema meldeten sich viele Männer zu Wort, die die Idee, nach dem Geschlechtsakt etwas Kaltes zu trinken, zwar ausdrücklich begrüßten, viele wollten aber lieber ein Bier.